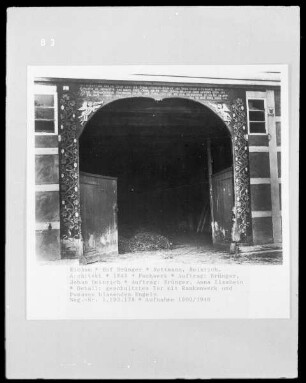Bestand
Brünger; Pfarrfamilie (Bestand)
Bestandsbeschreibung: Der Nachlass der Pfarrfamilie Brünger wurde 2020 im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in Bielefeld verzeichnet. Er umfasst 86 Verzeichnungseinheiten und erstreckt sich über den Zeitraum von 1783 bis 2001. Der Nachlass wird unter der Bestandsnummer 3.81 verwahrt. Der Nachlass dokumentiert das Leben und Wirken von drei Pfarrergenerationen der Familie Brünger: des Gründers der Pfarrerdynastie Wilhelm Brünger gen. Wördehecke (1832-1911), seiner Söhne Heinrich Brünger (1872-1937) und Theodor Brünger (1874-1951) sowie seines Enkelkindes Walther Brünger (1921-1987). Außerdem gibt der Nachlass Aufschluss über andere Familienangehörige der Großfamilie Brünger - Meier, auch wenn sie keinen Pfarrberuf ausgeübt haben. Friedrich Wilhelm Brünger gen. Wördehecke wurde am 17. August 1832 auf dem Heckenhof in Jöllenbeck als Sohn des Landwirtes und Leinewebers Friedrich Wilhelm Brünger und Anna Margaretha Tobusch, verwitwete Wördehecke, geboren. Er wurde beim Pastor Johann Heinrich Volkening konfirmiert. Volkening veranlasste, dass Wilhelm nach Gütersloh auf das neugegründete christliche Gymnasium kam und später in Halle Theologie studierte. Somit legte Volkening den Grundstein seines festen und lebendigen Glaubens. Nach dem Studium der Theologie an den Universitäten in Halle, Erlangen und Bonn hat Wilhelm Brünger sein Examen 1857 und 1859 in Münster abgelegt. Da ihm sich ein geistliches Amt nicht sofort bot, unterrichtete er bis 1860 am Gymnasium in Lemgo und danach an der Privatschule in Preußisch Oldendorf. 1862 bis 1866 war Wilhelm Brünger in Marienmünster, 1866 bis 1870 in Rödinghausen und 1870 bis 1909 in Exter als Pfarrer tätig. 1869 heiratete er Pauline Amalie Auguste Meier, Tochter des Gutsbesitzers aus Marienmünster, geheiratet; aus der Ehe gingen 13 Kinder hervor. Zwei Söhne von Wilhelm und Pauline sind Theologen geworden: Heinrich Gottlieb Brünger (17.10.1872-13.04.1937) bekam 1901 in Erda Kr. Wetzlar eine Pfarrstelle. 1909 wurde er in seiner Heimatgemeinde Exter als Nachfolger seines Vaters gewählt und blieb bis zum Tod 1937 im Amt. Otto Theodor Brünger (25.08.1874-30.12.1951) war 1909 bis 1913 Pfarrer in Wittel und 1909 bis 1944 Pfarrer und Anstaltsvorsteher in Wittekindshof. Der jüngste Sohn von Wilhelm, Friedel Brünger, geb. 1895, studierte ebenfalls Theologie. Er ist in Frankreich am 6. April 1918 gefallen. Die dritte Pfarrergeneration ist mit Walther Brünger (18.08.1921-04.01.1987), dem Sohn von Theodor Brünger, vertreten. Sein theologisches Studium begann er vor dem Krieg. Nach Kriegsdienst und Verwundung schloss er das Studium ab und wurde 1950 ordiniert. Walther Brünger war 1950 bis 1956 in Diakonissenanstalt Kaiserswerth, 1956 bis 1961 in Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Eben-Ezer in Lemgo/Lippe und 1961 bis 1972 in Diakonissenanstalt Kaiserswerth als Pastor tätig. Selbst kriegsblind, arbeitete er nach seiner Pensionierung ehrenamtlich im Christlichen Blindenverein Westfalen und wurde 1977 sein Vorsitzender. Der Nachlass ist in zwei Teilen dem Landeskirchlichen Archiv übergeben worden: 1985 von Pfarrer i.R. Walther Brünger und 2001 von seiner Witwe Dr. Christa Brünger. Einige Briefe waren vorsortiert, vermutlich von Walther Brünger. Der Nachlass bezieht sich zum größten Teil auf die Person von Wilhelm Brünger gen. Wördehecke (1832-1911). Die private Korrespondenz, an die Kinder gerichtet, zeugt von tiefer Frömmigkeit und Familienzusammenhalt. Die Briefe von Kommilitonen und Amtsbrüdern geben Einblicke in die Amtsgeschäfte der Männer der Erweckungsbewegung. Von den berühmten Persönlichkeiten, deren Briefe im Nachlass zu finden sind, sind Johann Heinrich Volkening und Clamorine Huchzermeier zu erwähnen. Seelsorgerliche Ermunterung kam von Volkening, als Wilhelm Brünger Pfarrer in der Diasporagemeinde Marienmünster war. Von Clamorine Huchzermeier sind mehrere Briefe an Wilhelm und Pauline Brünger überliefert. Es ist bekannt, dass Wilhelm während des Besuchs des Gymnasiums in Bielefeld von ihr betreut wurde. Es entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis, das lebenslang hielt. Unterlagen anderer Familienmitglieder sind ebenfalls historisch interessant. Sophie Brünger (1887-1916) litt unter Depressionen, wurde zeitweise in Bethel behandelt und starb jung. Die Briefe an das „liebe Sophiechen“ zeigen, wie die Familie mit dieser Krankheit umging und wie sie versucht hat, der Tochter einen Halt zu geben. Zahlreiche Briefe schildern Erlebnisse und Erfahrungen der Familie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Der jüngste Sohn von Wilhelm und Pauline wurde eingezogen und starb 1918 den „Heldentod“. Die Geschichte wiederholte sich im Zweiten Weltkrieg, als Helmuth (1915-1942), der Bruder von Walther Brünger, an der Ostfront fiel. Wilhelms und Paulines Sohn Wilhelm (1871-1959) hinterließ Briefe aus Südwestafrika, der Sohn Hans (1886-1967) wanderte nach Kanada aus und unterrichtete die Familie ebenfalls über seine Erfahrungen. Der Bestand wurde unter Zugrundelegung internationaler Verzeichnungsgrundsätze nach ISAD (G) erschlossen. Bei der Verzeichnung erhielten die Akten fortlaufende Nummern, die als gültige Archivsignaturen in der Bestellsignatur jeder Verzeichnungseinheit als letzte arabische Nummer oder im Findbuch ganz links neben dem jeweiligen Aktentitel aufgeführt sind. Unterhalb des Aktentitels geben die Vermerke „Enthält, Enthält nur, Enthält u.a., Enthält v.a., Enthält auch“ eingrenzende oder weiterführende Auskünfte über den Inhalt. Unter „Darin“ sind besondere Schriftgutarten wie Druckschriften, Presseberichte, Bauzeichnungen oder Fotos aufgelistet. Nach den Erschließungsvermerken folgt die alte Archivsignatur oder das Aktenzeichen, falls sie auf der Akte vermerkt waren. Ganz rechts schließen sich die Laufzeiten der Archivalien an. Zu beachten sind hier zwei verschiedene Arten von Klammern: ( ) verweisen bei Abschriften auf das Datum des Originals, [ ] kennzeichnen erschlossene Jahresangaben undatierter Schriftstücke. Kassiert wurde nicht archivwürdiges Schriftgut im Rahmen der Aufbewahrungs- und Kassationsordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20.02.2003 in der Fassung vom 29.10.2020 bzw. des Aufbewahrungs- und Kassationsplans der EKvW vom 29.10.2020. Sofern die Benutzung nicht zu Verwaltungszwecken erfolgt, unterliegen gemäß § 7 Abs. 1 Kirchengesetz zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut in der Evangelischen Kirche der Union (Archivgesetz - ArchivG) vom 6.5.2000 sämtliche Archivalien einer 30-jährigen Sperrfrist (gerechnet nach dem Ende ihrer Laufzeit). Für Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf natürliche Personen bezieht, gelten laut § 7 Abs. 2 ArchivG zusätzliche Schutzfristen. Diese Archivalien dürfen auch nach Ablauf der allgemeinen Sperrfrist frühestens 10 Jahre nach dem Tod der betroffenen Person(en) benutzt werden. Ist das Todesjahr nicht feststellbar, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach Geburt. Ist auch das Geburtsjahr nicht bekannt, endet die Schutzfrist 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen. Bei der Zitierung des Archivbestandes ist anzugeben: LkA EKvW 3.81 Nr. ... (hier folgt die Archivsignatur des entsprechenden Archivales). Das Kürzel steht in dieser Reihenfolge für "Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bestand 3.81 Nr. ..." Bielefeld, im Oktober 2020 Anna Warkentin Quellen und Literatur (Auswahl): Personalakte Wilhelm Brünger (1832-1911) (LkA EKvW 1 alt Nr. 227) Personalakte Heinrich Brünger (1872-1937) (LkA EKvW 1 alt Nr. 225) Personalakte Theodor Brünger (1874-1951) (LkA EKvW 1 alt Nr. 226) Rest-Personalakte Walther Brünger (1921-1987) (LkA EKvW 1 neu Nr. 3675) Zum Gedächtnis an Pastor Wilhelm Brünger zu Exter. Herausgegeben von Pastor Heinrich Brünger, Exter. - Gütersloh: C. Bertelsmann Verlag, - 48 S. (W 14221) Welch, Marianne: Erinnerungen an meinen Vater [Heinrich Brünger]. - 18 S. (W 20167) Brünger, Theodor: Die westfälische evangelische Heilerziehungs-, Heil- und Pfle-geanstalt Wittekindshof in Volmerdingsen bei Bad Oeynhausen: Darstellung ihrer Geschichte aus Anlaß ihres 50jährigen Bestehens / Theodor Brünger. - Biele-feld-Bethel, 1937. - 30 S. (W 1759) Brünger, Theodor: Der Liebesdienst an evangelischen Schwachsinnigen Westfa-lens in der Anstalt Wittekindshof / Theodor Brünger. - Schwelm: Meiners, 1927. - 20 S. (W 495) Wilhelm Brünger: Geboren den 31. Juli 1850 in Jöllenbeck. Gestorben den 18. März 1906 in Elberfeld. / Schneider. - Elberfeld, 1906. - 14 S. (W 14304) Magdalene Stricker, geb. Brünger: Erinnerungen an meinen Vater und an meine Mutter [Wilhelm und Pauline Brünger] (LkA EKvW 3.81 Nr. 42) Trauerrede von Altpräses Dr. Hans Thimme für Walther Brünger am 07.01.1987 (LkA EKvW 3.42 Nr. 135) Ulrike Winkler: „Ob es ein Abschiedsgruß für immer ist, steht in Gottes Hand.“ Kriegserleben und Kriegserfahrung der Familie Brünger 1914-1918. - In: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Band 114, 2018, S. 69-92 Hans-Walter Schmuhl: "... daß Verteidigung des evangelischen Glaubens gegen falsche Lehre nicht Kirchenpolitik ist." Der Wittekindshof, die Familie Brünger und der "Kirchenpampf". - In: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Band 114, 2018, S. 177-201 Hans-Walter Schmuhl: "Kritische Tage erster Ordnung". Der Wittekindshof, die Familie Brünger und die NS-"Euthanasie". - In: Jahrbuch für Westfälische Kir-chengeschichte, Band 114, 2018, S. 203-227 https://www.wittekindshof.de/presse/pressemitteilung/preID/der-wittekindshof-in-der-ns-zeit-zwangssterilisationen-ns-euthanasie-und-gleichschaltungspolitik-1/ (Stand 14.10.2020)
Form und Inhalt: Der Nachlass der Pfarrfamilie Brünger wurde 2020 im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in Bielefeld verzeichnet. Er umfasst 86 Verzeichnungseinheiten und erstreckt sich über den Zeitraum von 1783 bis 2001. Der Nachlass wird unter der Bestandsnummer 3.81 verwahrt.
Der Nachlass dokumentiert das Leben und Wirken von drei Pfarrergenerationen der Familie Brünger: des Gründers der Pfarrerdynastie Wilhelm Brünger gen. Wördehecke (1832-1911), seiner Söhne Heinrich Brünger (1872-1937) und Theodor Brünger (1874-1951) sowie seines Enkelkindes Walther Brünger (1921-1987). Außerdem gibt der Nachlass Aufschluss über andere Familienangehörige der Großfamilie Brünger - Meier, auch wenn sie keinen Pfarrberuf ausgeübt haben.
Friedrich Wilhelm Brünger gen. Wördehecke wurde am 17. August 1832 auf dem Heckenhof in Jöllenbeck als Sohn des Landwirtes und Leinewebers Friedrich Wilhelm Brünger und Anna Margaretha Tobusch, verwitwete Wördehecke, geboren. Er wurde beim Pastor Johann Heinrich Volkening konfirmiert. Volkening veranlasste, dass Wilhelm nach Gütersloh auf das neugegründete christliche Gymnasium kam und später in Halle Theologie studierte. Somit legte Volkening den Grundstein seines festen und lebendigen Glaubens.
Nach dem Studium der Theologie an den Universitäten in Halle, Erlangen und Bonn hat Wilhelm Brünger sein Examen 1857 und 1859 in Münster abgelegt. Da ihm sich ein geistliches Amt nicht sofort bot, unterrichtete er bis 1860 am Gymnasium in Lemgo und danach an der Privatschule in Preußisch Oldendorf. 1862 bis 1866 war Wilhelm Brünger in Marienmünster, 1866 bis 1870 in Rödinghausen und 1870 bis 1909 in Exter als Pfarrer tätig. 1869 heiratete er Pauline Amalie Auguste Meier, Tochter des Gutsbesitzers aus Marienmünster, geheiratet; aus der Ehe gingen 13 Kinder hervor. Zwei Söhne von Wilhelm und Pauline sind Theologen geworden:
Heinrich Gottlieb Brünger (17.10.1872-13.04.1937) bekam 1901 in Erda Kr. Wetzlar eine Pfarrstelle. 1909 wurde er in seiner Heimatgemeinde Exter als Nachfolger seines Vaters gewählt und blieb bis zum Tod 1937 im Amt.
Otto Theodor Brünger (25.08.1874-30.12.1951) war 1909 bis 1913 Pfarrer in Wittel und 1909 bis 1944 Pfarrer und Anstaltsvorsteher in Wittekindshof.
Der jüngste Sohn von Wilhelm, Friedel Brünger, geb. 1895, studierte ebenfalls Theologie. Er ist in Frankreich am 6. April 1918 gefallen.
Die dritte Pfarrergeneration ist mit Walther Brünger (18.08.1921-04.01.1987), dem Sohn von Theodor Brünger, vertreten. Sein theologisches Studium begann er vor dem Krieg. Nach Kriegsdienst und Verwundung schloss er das Studium ab und wurde 1950 ordiniert. Walther Brünger war 1950 bis 1956 in Diakonissenanstalt Kaiserswerth, 1956 bis 1961 in Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Eben-Ezer in Lemgo/Lippe und 1961 bis 1972 in Diakonissenanstalt Kaiserswerth als Pastor tätig. Selbst kriegsblind, arbeitete er nach seiner Pensionierung ehrenamtlich im Christlichen Blindenverein Westfalen und wurde 1977 sein Vorsitzender.
Der Nachlass ist in zwei Teilen dem Landeskirchlichen Archiv übergeben worden: 1985 von Pfarrer i.R. Walther Brünger und 2001 von seiner Witwe Dr. Christa Brünger. Einige Briefe waren vorsortiert, vermutlich von Walther Brünger.
Der Nachlass bezieht sich zum größten Teil auf die Person von Wilhelm Brünger gen. Wördehecke (1832-1911). Die private Korrespondenz, an die Kinder gerichtet, zeugt von tiefer Frömmigkeit und Familienzusammenhalt. Die Briefe von Kommilitonen und Amtsbrüdern geben Einblicke in die Amtsgeschäfte der Männer der Erweckungsbewegung.
Von den berühmten Persönlichkeiten, deren Briefe im Nachlass zu finden sind, sind Johann Heinrich Volkening und Clamorine Huchzermeier zu erwähnen. Seelsorgerliche Ermunterung kam von Volkening, als Wilhelm Brünger Pfarrer in der Diasporagemeinde Marienmünster war.
Von Clamorine Huchzermeier sind mehrere Briefe an Wilhelm und Pauline Brünger überliefert. Es ist bekannt, dass Wilhelm während des Besuchs des Gymnasiums in Bielefeld von ihr betreut wurde. Es entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis, das lebenslang hielt.
Unterlagen anderer Familienmitglieder sind ebenfalls historisch interessant. Sophie Brünger (1887-1916) litt unter Depressionen, wurde zeitweise in Bethel behandelt und starb jung. Die Briefe an das ”liebe Sophiechen“ zeigen, wie die Familie mit dieser Krankheit umging und wie sie versucht hat, der Tochter einen Halt zu geben.
Zahlreiche Briefe schildern Erlebnisse und Erfahrungen der Familie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Der jüngste Sohn von Wilhelm und Pauline wurde eingezogen und starb 1918 den ”Heldentod“. Die Geschichte wiederholte sich im Zweiten Weltkrieg, als Helmuth (1915-1942), der Bruder von Walther Brünger, an der Ostfront fiel.
Wilhelms und Paulines Sohn Wilhelm (1871-1959) hinterließ Briefe aus Südwestafrika, der Sohn Hans (1886-1967) wanderte nach Kanada aus und unterrichtete die Familie ebenfalls über seine Erfahrungen.
Der Bestand wurde unter Zugrundelegung internationaler Verzeichnungsgrundsätze nach ISAD (G) erschlossen. Bei der Verzeichnung erhielten die Akten fortlaufende Nummern, die als gültige Archivsignaturen in der Bestellsignatur jeder Verzeichnungseinheit als letzte arabische Nummer oder im Findbuch ganz links neben dem jeweiligen Aktentitel aufgeführt sind. Unterhalb des Aktentitels geben die Vermerke ”Enthält, Enthält nur, Enthält u.a., Enthält v.a., Enthält auch“ eingrenzende oder weiterführende Auskünfte über den Inhalt. Unter ”Darin“ sind besondere Schriftgutarten wie Druckschriften, Presseberichte, Bauzeichnungen oder Fotos aufgelistet. Nach den Erschließungsvermerken folgt die alte Archivsignatur oder das Aktenzeichen, falls sie auf der Akte vermerkt waren. Ganz rechts schließen sich die Laufzeiten der Archivalien an. Zu beachten sind hier zwei verschiedene Arten von Klammern: ( ) verweisen bei Abschriften auf das Datum des Originals, [ ] kennzeichnen erschlossene Jahresangaben undatierter Schriftstücke.
Kassiert wurde nicht archivwürdiges Schriftgut im Rahmen der Aufbewahrungs- und Kassationsordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 20.02.2003 in der Fassung vom 29.10.2020 bzw. des Aufbewahrungs- und Kassationsplans der EKvW vom 29.10.2020.
Sofern die Benutzung nicht zu Verwaltungszwecken erfolgt, unterliegen gemäß § 7 Abs. 1 Kirchengesetz zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut in der Evangelischen Kirche der Union (Archivgesetz - ArchivG) vom 6.5.2000 sämtliche Archivalien einer 30-jährigen Sperrfrist (gerechnet nach dem Ende ihrer Laufzeit). Für Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf natürliche Personen bezieht, gelten laut § 7 Abs. 2 ArchivG zusätzliche Schutzfristen. Diese Archivalien dürfen auch nach Ablauf der allgemeinen Sperrfrist frühestens 10 Jahre nach dem Tod der betroffenen Person(en) benutzt werden. Ist das Todesjahr nicht feststellbar, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach Geburt. Ist auch das Geburtsjahr nicht bekannt, endet die Schutzfrist 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen.
Bei der Zitierung des Archivbestandes ist anzugeben: LkA EKvW 3.81 Nr. ... (hier folgt die Archivsignatur des entsprechenden Archivales). Das Kürzel steht in dieser Reihenfolge für "Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bestand 3.81 Nr. ..."
Bielefeld, im Oktober 2020
Anna Warkentin
Quellen und Literatur (Auswahl):
Personalakte Wilhelm Brünger (1832-1911) (LkA EKvW 1 alt Nr. 227)
Personalakte Heinrich Brünger (1872-1937) (LkA EKvW 1 alt Nr. 225)
Personalakte Theodor Brünger (1874-1951) (LkA EKvW 1 alt Nr. 226)
Rest-Personalakte Walther Brünger (1921-1987) (LkA EKvW 1 neu Nr. 3675)
Zum Gedächtnis an Pastor Wilhelm Brünger zu Exter. Herausgegeben von Pastor Heinrich Brünger, Exter. - Gütersloh: C. Bertelsmann Verlag, - 48 S.
(W 14221)
Welch, Marianne: Erinnerungen an meinen Vater [Heinrich Brünger]. - 18 S. (W 20167)
Brünger, Theodor: Die westfälische evangelische Heilerziehungs-, Heil- und Pfle-geanstalt Wittekindshof in Volmerdingsen bei Bad Oeynhausen: Darstellung ihrer Geschichte aus Anlaß ihres 50jährigen Bestehens / Theodor Brünger. - Biele-feld-Bethel, 1937. - 30 S. (W 1759)
Brünger, Theodor: Der Liebesdienst an evangelischen Schwachsinnigen Westfa-lens in der Anstalt Wittekindshof / Theodor Brünger. - Schwelm: Meiners, 1927. - 20 S. (W 495)
Wilhelm Brünger: Geboren den 31. Juli 1850 in Jöllenbeck. Gestorben den 18. März 1906 in Elberfeld. / Schneider. - Elberfeld, 1906. - 14 S. (W 14304)
Magdalene Stricker, geb. Brünger: Erinnerungen an meinen Vater und an meine Mutter [Wilhelm und Pauline Brünger] (LkA EKvW 3.81 Nr. 42)
Trauerrede von Altpräses Dr. Hans Thimme für Walther Brünger am 07.01.1987 (LkA EKvW 3.42 Nr. 135)
Ulrike Winkler: ”Ob es ein Abschiedsgruß für immer ist, steht in Gottes Hand.“ Kriegserleben und Kriegserfahrung der Familie Brünger 1914-1918. - In: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Band 114, 2018, S. 69-92
Hans-Walter Schmuhl: "... daß Verteidigung des evangelischen Glaubens gegen falsche Lehre nicht Kirchenpolitik ist." Der Wittekindshof, die Familie Brünger und der "Kirchenpampf". - In: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Band 114, 2018, S. 177-201
Hans-Walter Schmuhl: "Kritische Tage erster Ordnung". Der Wittekindshof, die Familie Brünger und die NS-"Euthanasie". - In: Jahrbuch für Westfälische Kir-chengeschichte, Band 114, 2018, S. 203-227
https://www.wittekindshof.de/presse/pressemitteilung/preID/der-wittekindshof-in-der-ns-zeit-zwangssterilisationen-ns-euthanasie-und-gleichschaltungspolitik-1/
(Stand 14.10.2020)
- Bestandssignatur
-
3.81
- Kontext
-
Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen (Archivtektonik) >> 07. Nachlässe
- Bestandslaufzeit
-
1783-2001
- Weitere Objektseiten
- Geliefert über
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
06.03.2025, 18:28 MEZ
Datenpartner
Evangelische Kirche von Westfalen. Landeskirchliches Archiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1783-2001