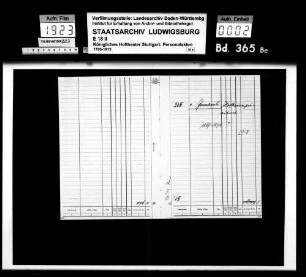Bestand
Nachlass Hieronymus Heinrich Hinckeldey, Regierungs- und Hofkammerpräsident (1720-1805) (Bestand)
Inhalt und Bewertung
Der Jurist Hinckeldey war in verschiedenen Positionen in den Jahren zwischen 1750 und 1783 der bestimmende Mann der löwenstein-wertheim-rochefortschen Verwaltung. Der Bestand umfasst privates und dienstliches Schriftgut und ist inhaltlich wie provenienzmäßig kaum von der Wertheimer Kanzleiüberlieferung zu trennen. Seinen Kern bilden Unterlagen, die sich bei Hinckeldeys Tod in seinem Wohnsitz bei Sinnershausen/Thüringen befanden und über das Staatsarchiv Marburg nach Wertheim kamen.
1. Zur Person des Hieronymus Heinrich von Hinckeldey: Hieronymus Heinrich Hinckeldey wurde am 6. Juli 1720 in Schweindorf geboren und wuchs wohl in der nahegelegenen freien Reichsstadt Nördlingen auf. Aus einer protestantischen Pfarrersfamilie stammend studierte er mit einem Stipendium der Stadt Nördlingen ab 1739 Jura in Jena (1). Schon als Kandidat der Jurispudenz übernahm er 1742 Rechtsvertretungen in Nördlingen und ist bereits im folgenden Jahr als Sekretär des dortigen Ratskonsulenten Georg Friedrich (von) Scheid greifbar. Im Februar 1745 trat er in die Dienste der Grafen zu Öttingen-Wallerstein ein, wo er als Regierungsrat fungierte (2). Die Heirat mit Friderica Rosina Maria Scheid 1746, der Tochter des erwähnten Ratskonsulenten, eröffnete ihm jedoch noch im selben Jahr die Möglichkeit, dem Schwiegervater in eine finanziell lukrativere Anstellung beim Fürsten zu Nassau-Weilburg zu folgen (3). Doch auch hier hielt es ihn nicht lange. Bereits im Mai 1750 bat er um seinen Abschied (4), wobei die Gründe hierfür nicht bekannt sind. Auf jeden Fall versuchte sich Hinckeldey in der Folgezeit in Frankfurt a. M. als Regierungsrat verschiedener Reichsstände zu etablieren (5). Durch die Vermittlung des Geheimen Rates Firnhaber wurde er jedoch schon Ende 1750 in die Dienste des Fürsten Carl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort aufgenommen (6), wo er - abgesehen von einer Unterbrechung in den 1770er Jahren - bis 1783 verblieb. In Wertheim gelang es Hinckeldey zur bestimmenden und einflussreichsten Persönlichkeit innerhalb der Beamtenschaft aufzusteigen (7): 1750 war er als Geheimer Hofrat und Kanzleidirektor eingestellt worden. 1753 erfolgte die Ernennung zum Lehensprobst. Ein Jahr später avancierte Hinckeldey zum Hofkanzler und zum Direktor in allen fürstlichen Kollegien. Den Höhepunkt seiner Karriere erklomm er schließlich 1763, als Fürst Carl Thomas ihn zum Regierungs- und Kammerpräsidenten ernannte, wodurch Hinckeldey als Protestant den beiden zentralen Regierungsorganen der katholischen Löwensteiner Linie vorstand. Doch schon zuvor hatte Hinckeldey das volle Vertrauen seines Fürsten genossen. So war er bereits früh an fast allen wichtigen Entscheidungen beteiligt: 1755 führte er z. B. als Abgesandter des Hauses Löwenstein-Wertheim-Rochefort in Wien den Vergleich mit dem Haus Stolberg über den Besitz der Grafschaft Rochefort herbei (8). Wie hoch Hinckeldey in der Gunst seines Herrn stand, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass Fürst Carl Thomas beim Kaiser 1754 eine Erhebung in den Reichsadelsstand für seinen damaligen Hofkanzler und dessen Nachkommen erwirkte (9). Zudem gelang es Hinckeldey in späteren Jahren zwei seiner Söhne in fürstlichen Diensten unter zu bringen (10). Der grosse Einfluß Hinckeldeys auf den Fürsten rief natürlich Neid und Abwehrreaktionen vieler anderer Beamter in Wertheim hervor. So entzündete sich z. B. am Verfahren bei der Neueinstellung von fürstlichen Bediensteten 1763 ein heftiger Disput zwischen ihm und dem Vizekanzler Schmid. Hinckeldey plädierte dafür, die Prüfung von Bewerbern dem Fürsten selbst zu überlassen, wohingegen Schmid diese Aufgabe der Regierung übertragen wollte. Letztlich verbarg sich hinter der Argumentation des Vizekanzlers die Furcht, Hinckeldey könne die Stellen aufgrund seines Einflusses auf den Fürsten bei dem von ihm bevorzugten Verfahren nur mit ihm ergebenen Leuten besetzen (11). Der Disput zwischen den beiden wurde mit spitzer Feder und wohl auch scharfer Zunge geführt. Doch derartige auch ins Persönliche gehenden Attacken stellten nichts Ungewöhnliches im Umgang der fürstlichen Dienerschaft miteinander dar (12). Der Präsident ging solchen Differenzen ohnehin nicht aus dem Weg und galt auch außerhalb Wertheims als ein durchaus streitbarer Zeitgenosse (13). Zur starken Position Hinckeldeys, die er des Öfteren auch gegenüber seinem Fürsten deutlich machte, dürfte neben seinen persönlichen Qualitäten nicht zuletzt auch seine weitgehende wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber seinem Dienstherrn beigetragen haben. Diese gründete zum einen auf seiner zweiten Heirat: Nach dem Tod seiner ersten Frau 1754 vermählte sich Hinckeldey zwei Jahre später mit Elisabeth Christiane Trier, die das Schloß und Gut Sinnershausen bei Meiningen in Thüringen in die Ehe brachte. Von allen Seiten wurde Hinckeldey zu dieser vorteilhaften Heirat gratuliert, wobei das Gut Sinnershausen nach Meinung des löwenstein-wertheim-rochefortschen Generalintendanten Lambert Sandkoul einen Wert von 100.000 fl. darstellen würde (14). Zum anderen trat er verschiedentlich als Kreditgeber und Kreditvermittler in Erscheinung - zuweilen sogar gegenüber seinem Fürsten Carl Thomas (15), was sowohl seine politische als auch seine finanzielle Situation stärkte. Zudem war Hinckeldey außerhalb seiner Dienstgeschäfte als juristischer Berater und Gutachter in verschiedenen Prozessen und Rechtsgeschäften aktiv. Eine Tätigkeit, die er bis zu seinem Tod beibehielt und durch die er bei seinen Zeitgenossen ein recht hohes Ansehen als Jurist genoss (16). So heißt es bei Christoph Weidlich in seinen 'Biographischen Nachrichten über jetztlebende Juristen in Deutschland': "Der Geheime Rat von Hinckeldey beweist in seinen Schriften vielen Scharfsinn, hat einen einnehmenden Vortrag..., weiß seine Gegenstände auf der besten Seite vorzustellen und das Augenmerk des Lesers dahin zu ziehen. Seine Schreibart ist nicht gekünstelt, aber natürlich schön und reiner als die seiner Zeitgenossen" (17). Im Jahr 1773 begab sich der löwenstein-wertheim-rochefortsche Präsident offiziell aus Alters- und Gesundheitsgründen in den Ruhestand. Er verpflichtete sich aber, dem Fürsten weiterhin - wenn auch in vermindertem Umfang - mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und bei Bedarf auf fürstliche Kosten von Sinnershausen nach Wertheim zu reisen, um die Regierungsgeschäfte zu leiten (18). Dafür erhielt er neben seiner Pension in Höhe von 1.500 fl. noch eine Gratifikation von 1.000 fl. im Jahr (19). 1780 stieg Hinckeldey dann noch einmal voll in die Regierungsarbeit ein. Doch schon drei Jahre später erfolgte die endgültige und vollständige Entlassung aus dem Dienst des Hauses Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Vermutlich resultierte dies aus dem sogenannten Wertheimer Wallfahrtsstreit 1781, für dessen Ausmaße die evangelischen Grafen zu Löwenstein-Wertheim den in Diensten der katholischen Linie stehenden Hieronymus Heinrich von Hinckeldey sowie dessen Sohn Johann Philipp verantwortlich machten (20). Hinckeldey selbst betrachtete seine Entlassung als das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Aktion eines Wertheimer Grafen mit der zweiten Gemahlin von Fürst Carl Thomas, Josepha Maria geb. von Stipplin (21). Nach seiner Demission zog er sich jedenfalls auf sein Gut nach Sinnershausen zurück, widmete sich dessen Verwaltung, diversen Finanzgeschäften sowie verschiedenen Rechtsvertretungen und vereinzelten diplomtischen Unternehmungen im Dienst der sächsischen Herzöge (22). Nach dem Tod seiner zweiten Frau 1793 übernahm sein Sohn Carl das Gut Sinnershausen und Hinckeldey siedelte nach Barchfeld über (23). Es wurde ruhiger um den alternden und kränkelnden Mann. Im Gelehrtenlexikon Hamberger/ Meusel wurde 1801 unter seinem Namen vermerkt: "Hinckeldey (Hieronymus Heinrich) soll gestorben sein: aber wer bezeugt es mit Gewißheit? Und wann geschah es?" (24). Zwar war dieser Nachruf verfrüht, doch vier Jahre später, am 19. Juli 1805, verstarb der ehemalige löwenstein-wertheim-rochefortsche Regierungs- und Kammerpräsident schließlich im hohen Alter von 85 Jahren.
2. Bestandsgeschichte: Der Arbeitsablauf von fürstlichen Verwaltungen im 18. Jahrhundert wies ein heute gänzlich unübliches Charakteristikum auf: Die Beamten erledigten ihre Amtsgeschäfte zum Großteil zu Hause. Demzufolge befanden sich in ihren Wohnungen gewöhnlich ihre Dienstakten, nebst den neu eingehenden Schreiben sowie ihren eigenen Notizen und Konzepten. Nach Beendigung der Aufgabe oder nach dem Ausscheiden aus dem Dienst wurden die Unterlagen in der Regel dann wieder an den Fürst bzw. dessen Verwaltung zurückgegeben. Zuweilen unterblieb dies jedoch, sei es aus Vergesslichkeit oder bei - unfreiwilligem Abtritt - mitunter auch mit Absicht und so entbrannte des Öfteren ein heftiger Streit um die zurückbehaltenen Akten. Auch beim Haus Löwenstein-Wertheim-Rochefort gibt es für das 18. Jahrhundert zahlreiche Anhaltspunkte auf eine solche Verfahrensweise und die daraus resultierenden Probleme (25). Dieser Verwaltungspraxis dürfte auch der Nachlass des Regierungs- und Kammerpräsidenten von Hinckeldey seine Entstehung zu verdanken gehabt haben. Hinckeldey hielt sich ab 1763 nämlich immer öfter auf seinem Gut Sinnershausen und immer weniger in Wertheim auf. Mitunter musste er nachdrücklich gebeten werden, in der fürstlichen Verwaltung zu erscheinen und seinen Dienstgeschäften vor Ort nachzugehen. Dies hatte zur Folge, dass ihm die fürstlichen Stellen Schreiben, Akten etc. nach Sinnershausen zusandten, wovon vieles nach seiner Bearbeitung dann dort liegen blieb. Nach dem Ausscheiden Hinckeldeys änderte sich an diesem Zustand zunächst wenig. Vereinzelt fahndete die löwenstein-wertheim-rochefortsche Regierung nach vermissten Akten auch bei Hinckeldey in Sinnershausen, und des Öfteren wurden dort befindliche Unterlagen auch wieder nach Wertheim zurückgeschickt (26). Mitunter verweigerte der ehemalige Präsident aber auch die Herausgabe der Akten, wie im Fall der Schreiben des Fürsten Joseph Johann an seinen Bruder Theodor Alexander zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort (27). Diese wollte Hinckeldey als Beweismittel in der Hinterhand behalten, um sich gegen eventuelle spätere Vorwürfe von Seiten der Brüder von Fürst Carl Thomas verteidigen zu können, die schon in den 1750er und 1760er Jahren gegen ihn vorgebracht worden waren - im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Primogeniturregelung des Hauses (28). Mit dem Tod Hinckeldeys 1805 sah man in Wertheim die Chance gekommen, das löwenstein-wertheim-rochefortsche Schriftgut endlich vollständig zurück zu erhalten (29). Hinckeldeys Sohn Carl war 1808 schließlich mit einer Überstellung der mittlerweile im Gesamtgericht Barchfeld versiegelt aufbewahrten Akten nach Wertheim einverstanden (30). Doch offensichtlich blieb dies aufgrund der Umwälzungen der damaligen Zeit nur ein Plan. Denn statt nach Wertheim gelangten die Akten der hinckeldeyschen Hinterlassenschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunächst in den Besitz des kgl. preußischen Staatsarchivs Marburg, das sie 1878 dem Haus Löwenstein-Wertheim-Rochefort zum Kauf anbot (31). Nach der Erstellung eines von Wertheimer Seite gewünschten "kurzen summarischen Inventars" (32)1882 plädierte der löwenstein-wertheim-rosenbergsche Archivrat Dr. Kaufmann für den Erwerb der Akten, da sie manches enthielten, "was entweder von Werth für uns ist oder was nicht wohl in fremde Hände geraten darf" (33). Doch obgleich der Kauf von der fürstlichen Verwaltung genehmigt wurde, dauerte es noch einmal bis 1891, ehe er endlich realisiert werden konnte. Gegen die Erstattung der Fracht- und Verpackungskosten in Höhe von 11 Mark und 55 Pfennig sowie eines Makulaturpreises von 5 Mark pro Zentner erwarb das löwenstein-wertheim-rosenbergsche Archiv schließlich sehr preiswert für insgesamt 43 Mark und 50 Pfennig die 319,5 kg Akten, welche in 26 Säcken nach Wertheim geliefert wurden (34). Sie fanden zunächst in der unteren Abteilung des Archivs im Turm einen Lagerplatz. In der Folgezeit scheint ihnen jedoch wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden zu sein, da sie weder richtig verzeichnet noch als Verbund bei den verschiedenen Umzügen des Archivs zusammengelassen wurden. Dies hatte zur Folge, daß auch nach der jetzigen Bearbeitung noch nicht alle Akten wieder aufgetaucht sind, die in dem Summarischen Inventar von 1882 aufgeführt worden waren.
3. Zum Inhalt des Bestands: Das Spektrum des Bestandes weist eine Mischung aus privatem und dienstlichem Schriftgut auf. Bei dem Privaten nehmen zum einen Rechnungen bzw. Rechnungsbeilagen einen breiten Raum ein. Daneben enthält er aber auch zahlreiche persönliche Unterlagen sowie umfangreiche private Korrespondentenakten von Hinckeldey und von seinen beiden angeheirateten Familien, insbesondere von der Familie seiner erster Frau Friderica Rosina Maria Scheid. Geographisch gibt es im Bereich des privaten Schriftguts zwei Schwerpunkte, über die man im Staatsarchiv Wertheim kaum Archivalien vermuten würde: Der erste ist die freie Reichsstadt Nördlingen, was durch die Herkunft Hinckeldeys bedingt ist. Neben verschiedenen Korrespondenzakten mit Verwandten, Freunden, Geschäftspartnern aus dieser Region sind auch eine ganze Reihe von Prozessunterlagen aus Hinckeldeys Nördlinger Juristentätigkeit in das Staatsarchiv Wertheim gelangt. Zeitlich sind sie hauptsächlich in den 1740er Jahren angesiedelt. Der andere Schwerpunkt ist das Schloss und Gut Sinnerhausen bei Meiningen in Thüringen. Für dieses Gut sind vor allem Verwaltungsschriftgut, aber auch Unterlagen zu Rechtsstreitigkeiten und Bauakten etc. erhalten. Darüber hinaus stammen manche der privaten und politisch-diplomatischen Korrespondenzakten, wie z.B. mit der Familie von Wechmar aus dem Raum um Meiningen (35). Diese Archivalien sind größtenteils in der Zeit zwischen 1760 und 1805 entstanden. Zu den recht kurzen Beschäftigungsverhältnissen Hinckeldeys bei den Grafen von Öttingen-Wallerstein und den Fürsten zu Nassau-Weilburg sind nur recht wenige Akten im Bestand enthalten. Aufschluss über die Verhältnisse bei Nassau-Weilburg geben jedoch die Schreiben von nassauischen Kanzlers Georg Friedrich von Scheid an seinen Schwiegersohn Hinckeldey (36), sowie seine Dienstakten und seine Prozessunterlagen in seinem Streit mit dem Fürsten bzgl. seiner Entlassung (37). Die Masse des dienstlichen Schriftguts entstammt allerdings eindeutig der Tätigkeit Hinckeldeys beim Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Neben zahlreichen und z.T. auch umfangreichen Korrespondenzen mit anderen fürstlichen Beamten, den Anweisungen von Fürst Carl Thomas an Hinckeldey und weiteren Briefwechseln mit anderen Mitgliedern der fürstlichen Familie, sind fast alle Bereiche der damaligen Verwaltung dokumentiert. So umfasst der Bestand zum einen eher diplomatisches Schriftgut, wie Akten über die Beziehungen des Hauses Löwenstein-Wertheim-Rochefort zum Reich und zum fränkischen Reichskreis, Lehenssachen oder etwa die Streitigkeiten des Hauses mit seinen Nachbarn. Er enthält aber auch Unterlagen in Bezug auf die Belastungen der löwenstein-wertheim-rochefortschen Herrschaften durch den Siebenjährigen Krieg. Daneben schließt er natürlich Polizei-, Justiz-, Kirchen-, Zunft- und Forstsachen mit ein, so z.B. Bürgerannahmen oder Verfahren wegen sogenannter Fornicationes, d.h. wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr und daraus folgender Schwangerschaft, deren sich verschiedene löwenstein-wertheimsche Untertanen nach damaligem Verständnis schuldig gemacht hatten (38). Einen breiten Raum nimmt das Schriftgut zur Finanz- und Rechnungsverwaltung von Löwenstein-Wertheim-Rochefort ein. Besonders hervorzuheben sind hierbei Akten zu den diversen Geld- und Kreditgeschäften des Hauses, aber auch zur Eintreibung von verschiedenen Abgaben, insbesondere in der Grafschaft Wertheim. Neben Unterlagen zur Verwaltung der böhmischen und niederländischen Gebiete, stellt das Verwaltungsschriftgut zur löwenstein-wertheim-rochefortsche Herrschaft Wetzdorf in Niederösterreich einen besonders wichtigen Fund dar, da damit eine Lücke in den Beständen des Staatsarchivs geschlossen werden konnte (39). Darüber hinaus finden sich im Bestand Akten zu Prozessen, in die Hinckeldey durch seine dienstlichen Aufgaben verwickelt war. Zu nennen sind hier vor allem die juristische Aufarbeitung der Wertheimer Konfessionsstreitigkeiten von 1781, der sogenannten Wertheimer Wallfahrt (40), sowie Prozesse vor Reichsgerichten gegen ehemalige Bedienstete des Fürsten wie dem Vizekanzler Johann Christian Schmid oder dem Hof- und Kammerrat Johann Christoph Friedrich von Olnhausen (41). Doch nicht allein durch diese letztgenannten Unterlagen erlaubt das neu erschlossene Archivgut tiefe Einblicke in die internen Verhältnisse der löwenstein-wertheim-rochefortsche Verwaltung. Auch zu Einstellung, Besoldung, interner Patronage, internen Streitigkeiten und zur Entlassung von Bediensteten ist Material aufgefunden worden. Außerdem beinhaltet der Bestand eine Masse an Bittschriften von Untertanen, aber auch landesfremden Personen, die sowohl an Fürst Carl Thomas als auch an Hinckeldey gerichtet waren. Darin ersuchten die Bittsteller hauptsächlich um materielle Unterstützung, Nachlass von Strafen, Übernahme in den fürstlichen Dienst u.ä. (42). Schließlich nehmen die Unterlagen zu den internen Auseinandersetzungen innerhalb des fürstlichen Hauses breiten Raum ein. Vor allem die Differenzen über die Primogenitur, über die Höhe der Apanagen für die nachgeborenen Brüder des Fürsten, aber auch über die Einrichtung von Fideikommissen sowie über Erbschaften und Streitigkeiten zwischen fürstlichen Ehepartnern sind hier zu nennen (43).
4. Bearbeiterbericht: Der Bestand wurde im Rahmen eines von der Kulturgutstiftung Baden-Württemberg finanzierten zweijährigen Projektes von Juni bis Dezember 1998 verzeichnet. Er ist Teil eines bis dahin noch unbearbeiteten Restbestandes des löwenstein-wertheim-rosenbergschen Archivs und war in rund 50 Kartons verpackt. Dabei befand sich das Archivgut teilweise noch im 'Urzustand'. Insbesondere die privaten Schreiben an Hinckeldey steckten zum Großteil noch in ihren Umschlägen, einige Schreiben waren gar noch versiegelt (44). Sie mussten deshalb zunächst geöffnet und geglättet werden. In Bezug auf seine Ordnung war das Schriftgut sehr disparat. Es bestand zu 80% aus Einzelblättern, ohne erkennbaren Aktenzusammenhang. Nur 20 % lagen in Gestalt formierter Sachakten vor. Dies erforderte umfassende Ordnungsarbeiten, zumal die Einzelblätter meist nur eingehende Schreiben darstellten, ohne dass sich daran ein Konzept für ein ausgehendes Schreiben oder sonst ein konkreter Bearbeitungshinweis außer dem Präsentatvermerk angeschlossen hätte. Dass sie aber bearbeitet worden waren, geht aus gelegentlichen Aufschriften auf den die Schreiben umgebenden Umschlägen hervor (45). Aufgrund dieser Ausgangslage gestaltete sich die Bildung von Sachakten schwierig. Um eine letztlich nicht gerechtfertigte Einzelblattverzeichnung zu vermeiden, mussten deshalb zum einen vermehrt Korrespondentenakten formiert werden. Zum anderen wurde der Rückgriff auf einen sehr allgemeinen Sachbetreff nötig, so dass sich zahlreiche Akten nur unter dem Titel "Regierungssachen" oder "Kammersachen" mit spezifischer Laufzeitangabe im Bestand befinden. Wo immer es möglich war, genoss der Sachaktenzusammenhang bei der Ordnung des Materials jedoch Vorrang vor den Korrespondenten- oder Sammelakten. Die erstellte Klassifikation teilt die Archivalien in privates und dienstliches Schriftgut und weist bei letzterem eine Spezifikation der einzelnen Dienstherren Hinckeldeys auf. Im Falle von Korrespondentenakten, die je nach Zeitabschnitt auf mehrere Klassfikationsrubriken zu verteilen gewesen wären, wurde die Systematik durchbrochen und alle Schreiben unter einem Klassifikationspunkt eingeordnet. Aus den Nummern 372 und 603 wurden vier mehrfach gefaltete Karten und Pläne entnommen, um sie in der Kartensammlung plan legen zu können. Sie tragen nun die Nummern StAWt-R, K 6296-6299. Die Entnahme wurde bei den entsprechenden Akten vermerkt. Der Bestand umfasst rund 10 lfd. m in 902 Nummern. Die Zitierweise lautet StAWt-R, NL 15 Nr. [x] Wertheim-Bronnbach, Dezember 1998 Dr. Martin Furtwängler
Nachtrag: Nach dem Auffinden weiteren zum Bestand gehörigen Schriftguts wurde dieser um 109 Nrn. ergänzt. Die neuen Titel tragen die Bestellnummern 910-1021. Die Nummern 903-909 sind nicht belegt. Es sind nunmehr so gut wie alle im Marburger Abgabeverzeichnis von 1882 verzeichneten Titel (s. o. 3. 1) im Bestand vorhanden. Dazu konnten zahlreiche einzelne Akten, zum Teil unter Erweiterung der Laufzeit, ergänzt werden. Der Bestand umfasst nun etwa 12 lfd. m. Vorwort und Klassifikation blieben unverändert, der Index wurde neu bearbeitet. Bronnbach, im Juni 2000. Dr. Robert Meier
Anmerkungen: (1) Hinckeldey erhielt für drei Jahre ein Stipendium in Höhe von 50 fl. jährlich; vgl. StAWt-R NL15 Nr. 68, Extract Nördlinger Ratsprotokoll vom 01.04.1739. (2) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 366, Extract Nördlinger Ratsprotokoll vom 08.02.1745; StAWt-R NL15 Nr. 128, Ernennungsurkunde des Fürsten Carl August zu Nassau-Weilburg vom 28.06.1746. (3) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 128, Ernennungsurkunde des Fürsten Carl August zu Nassau-Weilburg vom 28.06.1746. (4) StAWt-R, NL 15 Nr. 128, Schreiben von Hieronymus Heinrich von Hinckeldey an Fürst Carl August zu Nassau-Weilburg vom 08.05.1750 (Konzept). (5) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 180, Schreiben von Hieronymus Heinrich von Hinckeldey an den Staatsrat und Hofkanzler des Markgrafen von Baden-Baden, von Künninger vom 09.11.1750. (6) Vgl. Christoph Weidlich, Biographische Nachrichten von jetztlebenden Rechtsgelehrten in Deutschland, III, 1783, in: Deutsches biographisches Archiv 539, S. 377. (7) Vgl. für das Folgende: StAWt-R, NL 15 Nr. 335, passim; StAWt-R Rep. 18 Nr. 96, passim. (8) Vgl. vor allem StAWt-R, NL 15, Nr. 9, 164, 479, 581, 621, 688. (9) Vgl. StAWt-R, Rep. 18 Nr. 113, Extractus des fürstlichen Regierungsprotokolls vom 18.08.1754; StAWt-R, NL 15 Nr. 68, Reichsadelsdiplom vom 07.03.1754 (Kopie). (10) Sein Sohn Johann Philipp wurde unter Fürst Dominik Constantin gar Regierungspräsident. Sein Sohn Carl brachte es immerhin zum Hofrat. Ein derartiger Nepotismus war jedoch nichts Ungewöhnliches bei den Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort, wo es mehrere Beamtendynastien im 18. und 19. Jahrhundert gegeben hat; vgl. auch StAWt-R, NL 15 Nr. 193. (11) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 875, passim. (12) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 225, passim. (13) Vgl. Christoph Weidlich, Biographische Nachrichten S. 378 (wie Anm. 7). (14) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 269, Schreiben von Lambert Sandkoul an Hieronymus Heinrich von Hinckeldey vom 16.09.1756. (15) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 64, 163, 296. (16) Vgl. Christoph Weidlich, Biographische Nachrichten, S. 378 (wie Anm. 7). (17) Ebenda. (18) Vgl. StAWt-R, Rep. 18 Nr. 96, Reskript von Fürst Carl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort vom 17.03.1773 (Kopie). (19) StAWt-R, Rep. 18 Nr. 113, Reskript von Fürst Carl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort vom 28.04.1775 (Kopie). (20) Vgl. Christoph Weidlich, Biographische Nachtrichten, S. 382 (wie Anm. 7). (21) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 193, Schreiben Hinckeldeys an den Reichshofrat von Dietmar vom 22.04.1784. (Konzept). Für eine Beteiligung der Fürstin an einer allmählichen Entfremdung ihres Mannes von Hinckeldey sprechen noch weitere Indizien; vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 195, Schreiben von Fürst Carl Thomas an Hieronymus Heinrich von Hinckeldey vom 03.01.1778. (22) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 883. (23) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 61, passim. (24) Hamberger/Meusel, Das gelehrte Teutschland, 5. Auflage, IX, 1801, in: Deutsches biographisches Archiv 539, S. 384. (25) Auch im Falle der Akten, die sich in der Wertheimer Wohnung Hinckeldeys befanden, war dies so; vgl. StAWt-R, Rep. 18 Nr. 293, Schreiben von Johann Philipp von Hinckeldey an Fürst Carl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort vom 29.10.1783ff.; vgl. für andere löwenstein-wertheim-rochefortsche Beamte: StAWt-R, NL 15 Nr. 288, passim. (26) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 288, Extractus des fürstlichen Regierungsprotokolls vom 16.07.1790, mit Marginale Hinckeldeys vom 24.07.1790. (27) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 448-453. (28) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 454, Schreiben von Hieronymus Heinrich von Hinckeldey an Prinz Dominik Constantin zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort vom 30.03.1786 (Konzept). (29) Vgl. StAWt-R, Rep. 18 Nr. 293, Extractus des fürstlichen Regierungsprotokolls vom 12.08.1805. (30) StAWt-R, Lit B Nr. 1265, Schreiben von Carl von Hinckeldey an die Regierung in Wertheim vom 29.01.1808. (31) StAWt-R, Lit B Nr. 7435 II, Schreiben des kgl. Staatsarchivs Marburg vom 31.08.1881. (32) StAWt-R, Lit. B Nr. 7435 II, Schreiben des löwenstein-wertheim-rosenbergschen Archivs (Dr. Kaufmann) an das kgl. Staatsarchiv Marburg vom 04.07.1881 (Konzept). (33) StAWt-R, Lit. B Nr. 7435 II, Vortrag von Archivrat Dr. Kaufmann vom 01.09.1882. (34) StAWt-R, Lit. B Nr. 7435 II, Bericht von Müller vom 18.07.1891; Schreiben des kgl. Staatsarchivs Marburg an die löwenstein-wertheim-rosenbergschen Domänenkanzlei vom 04.09.1891. (35) StAWt-R, NL 15 Nr. 274. (36) StAWt-R, NL 15 Nr. 121f. (37) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 586, 814-820. (38) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 610, 855. (39) Die Herrschaft Wetzdorf kam zusammen mit dem Gut Rohrbach aus dem Erbe der ersten Gemahlin von Fürst Carl Thomas, Maria Charlotte geb. Herzogin zu Holstein-Wiesenburg, an das Haus Löwenstein-Wertheim-Rochefort. 1780 schenkte sie der Fürst seiner zweiten Frau Josepha Maria von Stipplin, die den Besitz aber bereits 1784 an den k.k. böhmisch-österreichischen Obristkanzler Graf Leopold Krakowsky von Kolowrat verkaufte; vgl. Norbert Hofmann, Inventar des löwenstein-wertheim-rosenbergischen Karten- und Planselekts im Staatsarchiv Wertheim 1725¿1835, Stuttgart 1983, S. 38. Die Wetzdorfer Papiere sind Hinckeldey wohl 1782 bei einer Mission in Wien nachgesandt worden und auf diese Weise in seinen Besitz gelangt; vgl. StAWt-R, Rep. 18 Nr. 293, Extractus des fürstlichen Regierungsprotokolls vom 09.1.1783.; vgl. zu Wetzdorf im Bestand z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 73-76, 372-375, 588, 672, 856f. (40) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 206, 268, 570f., 860 (41) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 285-287, 459-461, 473, 573, 859. (42) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 218, 224. (43) Vgl. hierzu StAWt-R, NL 15 V.2. (44) Vgl. z.B. StAWt-R, NL 15 Nr. 166. (45) Vgl. StAWt-R, NL 15 Nr. 8. Diese Akte trug die Aufschrift Hinckeldeys ¿Beantwortete Schreiben und andere Reponenda¿; vgl. auch StAWt-R, NL 15 Nr. 601.
- Reference number of holding
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Wertheim, R-NL 15
- Extent
-
12 lfd. m in 1025 Einheiten
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Wertheim (Archivtektonik) >> Rosenbergisches Archiv >> Nachlässe
- Related materials
-
Literatur: Martin Furtwängler, Hinterlassenschaft eines Beamten- und Juristenlebens im 18. Jahrhundert - Zum Nachlaß des löwenstein-wertheim-rochefortschen Regierungs- und Kammerpräsidenten Hieronymus Heinrich von Hinckeldey (1720-1805), in: Wertheimer Jahrbuch 1999, S. 197-216.
- Indexentry person
- Date of creation of holding
-
1563-1810
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rights
-
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
- Last update
-
25.03.2024, 1:33 PM CET
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- 1563-1810