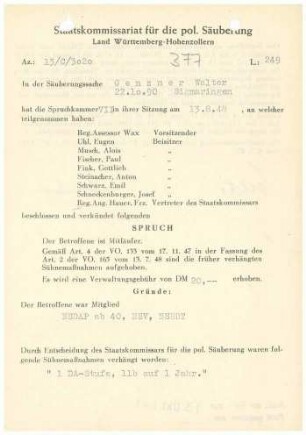Bestand
Nachlass Walther Genzmer, Architekt, Konservator (1890-1983) (Bestand)
Überlieferungsgeschichte
1. HERTA GENZMER: Zur Person von Walther Genzmer
Walther Genzmer entstammte einer Gelehrtenfamilie aus dem Landkreis Marienwerder in Ostpreußen. Als er am 22.10.1890 zur Welt kam, war sein Vater beim Bauamt der Stadt Köln angestellt, doch bald zog er als Stadtbaurat nach Halle/Saale, wo heute noch sein Andenken fortlebt.
Im Kreise munter mimender und musizierender Geschwister wuchs Walther, der Älteste, auf. Alle Musen geleiteten ihn von früh an freundlich, aber seine "unsterbliche Geliebte", "Frau Musica", war schon damals seine große Herrin, die Führerin, der auch der verehrungswürdige Vater diente. Aus dessen wunderbar ergreifender Naturstimme klang seine warme Menschlichkeit und tiefe Bildung. "Das Volk, das im Finstern wandelt, sieher ein großes Licht (Messias) und "In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht (Zauberflöte) - diese edlen Klänge schönster deutscher Musik prägten den Geist des Kindes. Als Mann wich er nie von den höchsten Idealen ab, weder in der Musik, die ihn immer begleitete, noch in der Baukunst, der späteren Grundlage seines Berufs.
Einem anderen Einfluss war das Schulkind aufgetan: der evangelischen Tradition der Stadt Halle. Bis ans Lebensende sprach er voller Verehrung von seinem Gymnasialdirektor Goedersdorf: "Jungs, s' ist morgen Bußtag, da habt ihr frei, aber ich bitte mir aus, dass ihr alle zur Kirche geht." (Alle Lehrer hielten sich an die tägliche Morgenandacht.)
1904 folgte Vater Ewald einem Ruf an die Danziger TH, wo er bis 1911 Hoch- und Tiefbau lehrte. Nebenher ging der Dienst für "Frau Musica": in Kirchenkonzerten in und um Danzig sang Prof. Genzmer, auf der Orgel begleitet von seinem Söhnchen Walther, der kaum an die Pedale reichte aber schon begann, sich im Stillen zu einem guten Organisten zu bilden.
Ganz von selber wuchs er sich, hingerissen von seinem "Heiligen" - Joh. Seb. Bach - zum profunden "Bachanten" und Orgelkundigen aus - das sollte ein wertvoller Bestandteil der Tätigkeit als Konservator werden.
Walther besuchte nun in Danzig das Städtische humanistische Gymnasium. Schularbeiten spielten keine Rolle, der Junge spielte Klavier und Tennis, lief am Strande herum und machte mit 18 Jahren als einer der Besten das Abitur.
Auch in und um Danzig sammelte er Geschichten und lustige Erlebnisse im reinsten Danziger Dialekt, wie vordem sächsische Witze in Halle und später in anderen deutschen Landen - eine Quelle dauernden Vergnügens.
Von den Gymnasiallehrern waren einige ihm lange noch gegenwärtig und immer blieb er dankbar dafür, dass die ganze Prima hindurch nur die deutschen und griechischen Klassiker gelesen wurden. Bis zu seinem Ende zitierte er voller Begeisterung Goethe, Schiller und lange Stücke aus der Ilias.
Auf den klugen Rat des Vaters studierte nun der Sohn nicht Musik, sondern Architektur und Kunstgeschichte, und es wurde eine ebenso vergnügliche wie bereichernde Studienzeit. Es lehrten damals mehrere hervorragende Professoren, von denen leider dann der Krieg die meisten verschlang: Ostendorf, Matthei, Carsten, Phleps und der besonders beliebte Carl Weber (Bruder von Max Weber), der sich persönlich ausgiebig mit seinen Studenten abgab.
Es war die Zeit des später viel geschmähten Historismus, der aber wohl eine gute Grundlage für das Studium bildete. Er beendete seine Studien in Danzig, nachdem der Vater 1911 als "Königl. Sächsicher Hof- und Baurat" nach Dresden gegangen war, mit Prädikatsexamen. Das Stipendium, das er dafür erhielt, wurde während des Krieges immer geringer, aber Anfang der Zwanziger Jahre machte er während eines Urlaubs eine längere Reise durch Italien, meistens zu Fuß, unterstützt von einem wohlmeinenden Onkel. Diese Fahrt vertiefte seine künstlerische Vorstellungen, sie war die alte klassische Bildungsreise.
Als 191 4 der Krieg ausbrach, war Walther wegen eines Herzfehlers vom Kriegsdienst befreit worden und wurde stattdessen in den preußischen Staatsdienst aufgenommen. An den Regierungen von Naumburg und Merseburg wurde er von ebenso tüchtigen und kenntnisreichen wie verehrungswürdigen preußischen Bauräten ausgebildet und gewann dort die tiefsten Eindrücke in romanische Plastik und Architektur. Im Privatleben verschaffte ihm die Musik überall Freunde und öffnete ihm Herzen und Türen musizierender Menschen aller Kreise.
Schon im Ersten, wie auch im Zweiten Weltkrieg verlangte die jeweilige Regierung von den Kirchen die Ablieferung der Glocken zum Einschmelzen für Kanonen, aber in beiden Fällen sorgten die Denkmalspfleger unter Führung des Staatskonservators in Berlin dafür, dass nur die neueren, weniger wertvollen Glocken abgeliefert werden mussten. Die alten, schön gegossenen und verzierten Glocken konnten gerettet werden. Der junge Genzmer vertiefte sich in die Glockenkunde, eine Wissenschaft für sich, und bildete sich darin zum Sachverständigen aus. Auch dieses ein wertvoller Bestandteil seiner Tätigkeit in Hohenzollern!
Die Glocken sollten ihn den Krieg 1939-1945 hindurch intensiv beschäftigen. Es war eine große Genugtuung für ihn, dass er vielen Gemeinden ihre schönen alten Glocken retten konnte. Seine Musikalität war auch dabei eine Hilfe, denn er erkannte schon am Klang den Wert einer Glocke.
Im Jahre 1918 machte Walther in Berlin sein Examen als Diplom-Ingenieur. Seine ersten Stationen als Regierungsbaumeister waren Homburg und Wiesbaden. Zwar wurde die ganze dortige Regierung Anfang der zwanziger Jahre von den Franzosen verjagt, jedoch wiederriefen sie bald diese sinnlose Maßnahme und Walther, der zwischendurch zu Hause Zuflucht gefunden hatte, kehrte nach Wiesbaden zurück.
Auch hier folgte er außerhalb des Dienstes "Frau Musica", die ihm mehrere große Häuser führender Wiesbadener Familien öffnete. Überall war er als Pianist geliebt und bewundert, als Begleiter für Sänger und alle Instrumentalisten, wie auch geschätzt als launiger Unterhalter, der stundenlang Christian Morgenstern auswendig vortragen konnte.
Im Jahre 1926 wurde Walther Genzmer in der Potsdamer Garnisonkirche mit einer preußischen Offizierstochter getraut. Als er dort am Altar kniete, umrauscht von herrlichen Bach'schen Orgelklängen, leise umweht von den schön gezierten, ruhmbedeckten Fahnen brandenburgischer und preußische Regimenter und gegenüber den Särgen der beiden Preußenkönige, ahnte er nicht, dass er 25 Jahre später die letzten Fahnen und die schwer beschädigten Särge auf der Zollernburg in seine Obhut nehmen sollte. Die Särge ließ er vom bedeutenden Kunstschmied Rieger in Oberuhldingen in stilgerechte Bronzesärge setzen und in die evangelische Schlosskirche stellen. Über ihnen wehen leise die letzten geretteten Fahnen.
Im Jahre 1927/28 erhielt Genzmer den Auftrag, das Wiesbadener Regierungsgebäude zu erweitern. Er entwarf diesen Bau und führte ihn aus; heute steht dieser Bau unter Denkmalschutz. Der Regierungsbaumeister sollte für diese Leistung mit der Beförderung zum Baurat belohnt werden, doch der Staat Preußen war 10 Jahre nach Kriegsende zu arm, um genügend Planstellen einzurichten. Immerhin 38 Jahre alt wurde der Regierungsbaumeister nun! Da man ihn nicht befördern konnte, belohnte seine Behörde ihn - durch die Vermittlung seines Personalreferenten, Geheimrat Eggert, eines jener menschlich so wohlwollenden Beamten im damaligen Preußen - mit der Versetzung ins Preußische Finanzministerium nach Berlin, bei dem die Abteilung "Preußische Bauzeitschriften" bestand.
Dort am "Kastanienwäldchen" konnte Walther Genzmer von 1928 bis 1933 in Ruhe arbeiten. Seine Frau Herta schenkte ihm zwei Töchter geworden, die er nach Dienstschluss an sei nemherrlichen Steinway in die großartige Welt der Musik einführte, sofern er ihnen nicht Märchen von Grimm und Andersen vorlas, Tausendundeinenacht, die deutschen Sagen von Schwab und Hauff. Später nahm er sie auf seinen Kunstwanderungen mit und unterwies sie in deutscher Kunstgeschichte.
Aber 1933 war es mit aller Ruhe vorbei, als die Nazis seine Abteilung Bauzeitschriften auffliegen ließen. 1929 hatte er auf der Weltausstellung in Barcelona Mies van der Rohe kennen gelernt und ihn sowie andere zeitgenössische Baumeister der "Berliner Brücke" wie Taut, Poelzig und andere besprochen - Grund genug für die Nazis, seine Abteilung für Bauzeitschriften aufzulösen. Eine günstige Fügung war es dann, dass die Denkmalpflege im schönen alten Berlin ihn beschäftigen konnte - eine gute Vorbereitung für die spätere Tätigkeit. Dieses Amt befand sich im berühmten Eck-Erker des Berliner Schlosses.
Doch das Leben im Nazi-Berlin machte ihm keinen Spaß mehr; auch wollte das Ehepaar die Kinder in ein moralisch gesünderes Klima bringen. So ergriff er die Gelegenheit, sich nach Sigmaringen versetzen zu lassen, als das Bauamt der dortigen preußischen Regierung frei wurde.
Eben hatte sich das Ehepaar mit dem Schwager von Dietrich Bonhoeffer, Rüdiger Schleicher, und mit dessen Frau angefreundet. Dort lernten die Genzmers auch beide Brüder von Frau Schleicher kennen, beide Bonhoeffers, damals noch ganz schlichte und vergnügte junge Männer, sowie ihren Freundeskreis. Damals konnte man sich noch ungestraft über die Begeisterung (für die Nazis) lustig machen und tat es auch. Bald sollte das vorbei sein.
Inzwischen trat Genzmer am 1.1.1934 seine Stelle beim Bauamt Sigmaringen an und übernahm gleichzeitig das Ehrenamt des Konservators der Hohenzollernschen Lande!
Eine einzigartig günstige Situation fand Genzmer in Sigmaringen vor: es lebten dort so gute Kunsthandwerker wie im ganzen Reich nicht, ausgenommen etwa in Bayern. Der Denkmalpfleger ist auf die guten Kunsthandwerker auf allen Gebieten angewiesen: Schnitzer, Vergolder, Restauratoren von Gemälden und Fresken, Stuckateure, Kunstschlosser und Kunstschmiede usw. In Sigmaringen waren es sowohl einzelne großartige Persönlichkeiten wie auch ganze Familien begabter Künstler und Kunsthandwerker mit denen sich beste Freundschaftliche Zusammenarbeit ergab.
In Sigmaringen wusste 1934 niemand, was es mit dem Nationalsozialismus auf sich hatte. Genzmer klärte den evangelischen Pfarrer über die "Deutschen Christen" auf und stellte sich ihm als ehrenamtlicher Hilfsorganist zur Verfügung.
Die Tätigkeit als Konservator befriedigte Genzmer außerordentlich und er sah dort so viel, was zu tun war, dass er bald darauf die lange ausstehende Beförderung zum Baurat mit Versetzung nach Königsberg ablehnte.
Gleich als Genzmer 1934 mit der Inventarisierung der kirchlichen Kunstwerke begann, sagten die Landpfarrer zueinander über ihn: "s' isch a Preiss, und a Proteschtant, und nu fangt¿ r a inventarisiere! Was wird er uns alles fortnehme?" Das erzählten sie später lachend ihrem Konservator, nachdem sie erlebt hatten, dass er ihnen gerade alles, ihr ganzes wertvolles Kulturgut konservierte! Und sie hatten das Vertrauen, ihm in allen seinen Forderungen zu folgen - 2/3 war Befreiung vom frommen Kitsch des 19. Jahrhunderts. Und das Freiburger erzbischöfliche Ordinariat hatte so viel Vertrauen in diesen protestantischen Preußen, dass es ihn völlig frei schalten und walten ließ.
Durch die Tätigkeit als Konservator geriet Genzmer, der sich von jeher als Preuße gefühlt hatte, von selber in den Dienst für das "vormals regierende Preußische Königshaus", denn zum Lande Hohenzollern gehörte außer Sigmaringen auch Hechingen und somit auch die Zollerburg. Dort begann er sogleich mit der völligen Instandsetzung de rBurg und ihren beiden Kapellen, von denen die katholische gotische Michaelskapelle mit all ihren Schätzen ihn fesselte und jahrelang beschäftigte, besonders im Kriege, als die wertvollen schönen Fenster zu ihrem Schutz ausgelagert werden mussten.
Im Rahmen seiner Tätigkeit als Landeskonservator übernahm er die Inventarisierung und Herausgabe der Neubearbeitung der Kunstdenkmäler Hohenzollerns. Er hatte dabei mehrere Mitarbeiter (Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns, im Auftrage des Landeskommunalverbandes der Hohenzollerischen Lande herausgegeben von Walther Genzmer, Erster Band: Kreis Hechingen, bearbeitet von Friedrich Hoßfeld und Hans Vogel, Hechingen: Holzinger & Co. 1939; Zweiter Band: Kreis Sigmaringen, bearbeitet von Friedrich Hoßfeld, Hans Vogel und Walther Genzmer, Stuttgart: W. Spemann 1948).
Ein Bildband über Hohenzollern mit Aufnahmen von Helga Schmidt-Glassner erschien 1955 (Walther Genzmer: Hohenzollern, München: Deutscher Kunstverlag 1955).
Nach dem Kriege baute er auf der Burg Hohenzollern die heute weltbekannte Preußen-Ausstellung auf, sammelte "Reliquien" des Hauses Preußen, teils Geschenke, teils von ihm besorgte Anschaffungen, die Pèsnes, Menzels, die Flöten, Krückstöcke, Tabaksdosen vom "Alten Fritz", den Reitrock der Königin Luise und ihre Toilettenservice, und vor allem sorgte er dafür, dass die Sammlung Edwin von Campe, eine Sammlung von Weltgeltung, die Hunderte zeitgenössischer Porträtstiche des großen Königs umfasst, auf die Burg Hohenzollern gelangte. Der zweibändige Katalog der Sammlung befindet sich im vorliegenden Bestand (Bestellnummer 8).
Auch die Privatgemächer des Kronprinzen und der Kronprinzessin richtete er ein und schaffte mit der Instandsetzung der großen Halle dem Grafensaal den Raum für die Wohltätigkeitskonzerte von Prinzessin Kira. Ferner wurde die Gruftkapelle instandgesetzt und vieles andere mehr.
Gleichzeitig restaurierte Genzmer in Hohenzollern im Laufe der 33 Jahre seiner dortigen Tätigkeit über 120 meist katholische Kirchen und Kapellen, einfache Dorfkirchen und herrliche Werke wie die benediktinische Erzabtei Beuron im Donautal, bei deren Äbten und Patres er mit seinen Kenntnissen und seiner natürlichen Menschlichkeit ein stets gern gesehener Gast war. Zu seinen bedeutendsten Instandsetzungen gehört die Abteikirche, die er von der frommen Verfremdung des düsteren 19. Jahrhunderts befreite und wieder im heiteren Glanz des Spätbarock erklingen ließ, ähnlich wie etwa die Pfarrkirche in Sigmaringen.
In seiner Jugend hatte man den Barock wiederentdeckt, und er hatte sich so ausgiebig damit beschäftigt, dass er zum profunden Kenner der "Vorarlberger Baumeister" sowie der "Wessobrunner" Stuckateure geworden - alle diese Kirchen in ihrer strahlenden Heiterkeit wieder erstehen lassen konnte. Das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg, zu dem diese Kirchen meistens gehören, erklärt heute die "Genzmersche Ära als glanzvoll" in Bezug auf die Denkmalpflege. Auch die Kollegen in der Denkmalpflege erkennen den großen Wert dieser Instandsetzungen bewundernd und zustimmend an. Zudem war Genzmer überall mit seinem unverwüstlichen Humor und seiner Gabe, witzige Reime zu "schütteln" und amüsante kleine Verse zu verfassen, sehr gerne gesehen.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Genzmer bei seiner Tätigkeit freundschaftlich begleitet wurde von dem Ehepaar Fürst und Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen. Besonders Fürstin Margarete, die musisch hochbegabte Tochter des letzten Königs von Sachsen, wusste Genzmers Tun zu würdigen und unterstützte ihn, wo sie nur konnte. Ihr Verständnis für ihn förderte ihn, und ihre hochherzige Freundschaft half ihm und der Familie über die schwersten Nachkriegsjahre hinweg. Die Zeit der französischen Besetzung - ein inhaltsreiches Kapitel: viel Ung emach - viel verständnisvolle Freundschaft.
Während des ganzen Dritten Reichs schrieb er keine Zeile und redete kein Wort als Verbeugung vor der "wunderbaren Belebung deutscher Kunst und Kultur" oder wie die Redensarten hießen, die manche Kunsthistoriker in ihren Werken einfließen ließen. Er war nicht in der Partei und in dem kleinen Städtchen wusste jeder, wie man im Hause Genzmer dachte. Dort fanden z.B. kleine Versammlungen der "Una Sancta" statt, Gespräche zwischen Theologen und Laien beider Konfessionen, auch ein Pfarrer der Bekennenden Kirche war dabei. Man war sich da wunderbar einig. Die Gestapo beobachtete das alles, aber durch gnädige Fügung ging alles gut ab.
1954 wurde Walther Genzmer Leiter des Bauamts Heilbronn und zum Oberbaurat befördert. In diesem Amt kümmerte er sich vor allem um die Verglasung des Ostfensters der Maulbronner Klosterkirche.
Auch nach seiner Versetzung in den Ruhestand 1956 blieb er ehrenamtlicher Landeskonservator von Hohenzollern. Erst 1967, also mit 77 Jahren, legte Genzmer die so geliebte Tätigkeit nieder und zog für 10 Jahre nach Berlin, auf das Liebenswürdigste aufgenommen von den dortigen Kollegen. Diese Jahre waren noch außerordentlich reich durch den Verkehr mit bedeutenden Menschen, sowie auch durch die Teilnahme am "Humboldtzentrum" mit seinen stimmungsvollen Abenden in Schloss Tegel.
Nach Berlin hatte seine zweite Tochter ihn geholt, doch 1976 machte die ältere Tochter ihre Ansprüche geltend und versetzte die Eltern in ihre Nähe nach Godesberg, wo Genzmer sich rasch einlebte doch bald zu kränkeln begann. Er erblindete und erlahmte, und sein reger Geist verzog sich von dieser Welt in jene andere, von der wir hoffen, dass sie so schön ist, wie solche ideal gesonnenen Menschen sie sich immer vorstellen. An seinem Grabe sagte der Pastor: "Sein ganzes Leben war ein selbstloser Dienst an der Schönheit als Abbild der Wahrheit." Nach schweren Leidenszeiten kam der Tod als Erlöser am 13. Juni 1983.
Ein Mensch, so weit gespannt, so umgänglich und so wohlwollend, hat viele Freunde. Auch der Beruf, ferner seine Liebe zur Musik, und schließlich sein "offenes Haus", in dem auch in den ärmsten Jahren Gäste aufgenommen wurden - alles dieses brachte eine große Schar von Freunden in sein langes Leben: liebe und geistreiche Menschen aller Kreise, u.a. auch den damals bedeutendsten katholischen Dogmatiker, den Tübinger Professor Karl Adam, Vorvorläufer von Professor Küng. Sein Buch "Vom Wesen des Katholizismus" wurde in 9 Sprachen übersetzt. Karl Adam besuchte die Familie Genzmer in Sigmaringen häufig und man war sich religiös in Richtung "Una Sancta" ebenso einig wie politisch, nämlich gegen den Nationalsozialismus eingestellt. Durch Prof. Adam lernte Genzmer noch andere bedeutende Persönlichkeiten kennen, wie den Kardinal König (Wien).
Nach 1945 war das Sigmaringer Haus voll von geflüchteten Verwandten. Später verkehrten dort auch Fabian v. Schlabrendorff, Prof. Hans Rothfels, Graf Paul Yorck und Eduard Spranger, dieser verehrungswürdige Preußische Gelehrte alten Stils: voll tiefer Bescheidenheit bei tiefem Wissen. Als Mitglied der "Mittwochsgesellschaft" sollte auch er umgebracht werden, wurde nur durch die Vermittlung der japanischen Botschaft in Berlin gerettet und schenkte dem Hause Genzmer noch spät die Freundschaft seiner letzten Lebensjahre.
(aus: N 1 / 83 Nr. 4)
2. Bestandsgeschichte und Bearbeiterbericht
Der Nachlass Walther Genzmers wurde im April 2006 von seiner Tochter Mechthild Genzmer, Bonn, dem Staatsarchiv Sigmaringen geschenkt und im Mai 2006 von dem Praktikanten Gerold Rebholz unter Anleitung von Dr. Volker Trugenberger verzeichnet. Der Verzeichnung liegen die von Mechthild Genzmer gebildeten Einheiten zugrunde. Corinna Knobloch besorgte die Endredakt ion. Die Bestellnummern 23 und 24 wurden von Mechthild Genzmer im Juli 2008 dem Staatsarchiv geschenkt. Im Januar 2009 übergab Mechthild Genzmer Dienst-, Ehren- und Ordensverleihungsurkunden sowie das ihrem Vater verliehene Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Diese Unterlagen wurden in die Bestellnummer 2 eingeordnet.
Der Bestand umfasst 24 Einheiten in 1,1 lfd.m.
Im Februar und März 2013 wurden die Fotografien in den Bestellnummern 12 und 22 durch den Praktikanten Björn Buschle unter Anleitung von Sibylle Brühl erschlossen und archivgerecht verpackt. Die Fotografien, die ursprünglich in der Bestellnummer 22 lagen, sind nun unter den Bestellnummern 25-102 zu finden. Der Bestand umfasst seither 102 Verzeichnungseinheiten.
Björn Buschle
Sibylle Brühl
- Reference number of holding
-
Abt. Staatsarchiv Sigmaringen, N 1/83
- Extent
-
102 Einheiten (1,2 lfd.m)
- Context
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Sigmaringen (Archivtektonik) >> Nachlässe, Partei-, Vereins- und Verbandsarchive >> Nachlässe >> Nachlass Walther Genzmer, Architekt, Konservator (1890-1983)
- Indexentry person
- Date of creation of holding
-
1891-1987
- Other object pages
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rights
-
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
- Last update
-
03.04.2025, 8:37 AM CEST
Data provider
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Bestand
Time of origin
- 1891-1987