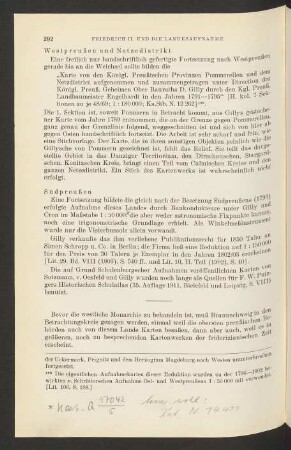Bestand
Südpreußen (Bestand)
Findmittel: Datenbank; Findbuch, 3 Bde.
A. Behördengeschichte
I. Besitznahme Südpreußens und erste Verwaltungsmaßnahmen
II. Die Verwaltung der Justiz-, Hoheits- und Lehnsangelegenheiten
III. Die Verwaltung der geistlichen und Schulangelegenheiten in Süd- und Neuostpreußen
B. Kanzlei- und Registraturgeschichte
C. Bestandsgeschichte
D. Hinweise
I. Quellen- und Literaturhinweise
1. Quellen
a) gedruckte Quellen
b) ungedruckte Quellen
2. Darstellungen
II. Ergänzende Bestände
A. Behördengeschichte
I. Besitznahme von Südpreußen und erste Verwaltungsmaßnahmen
Die am 23. Januar 1793 in Petersburg geschlossene preußisch-russische Konvention legte die 2. Teilung Polens fest. Danach erhielt Preußen außer den ihm bereits in der 1. Teilung zugesprochenen Gebieten die Städte Danzig und Thorn, die der Provinz Westpreußen einverleibt wurden, sowie den größten Teil des heutigen Zentralpolens. Es handelte sich um ein Gebiet von etwa 1060 Quadratmeilen mit ca. 1 150 000 Einwohnern.
Bereits einen Tag nach Abschluss der Konvention überschritten preußische Truppen unter General Möllendorff bei Schwerin an der Warthe die polnische Grenze, Anfang März war die militärische Besetzung beendet.
Die offizielle Besitznahme sollte gemäß der Konvention in der Zeit vom 5. - 21. April erfolgen. Zum 1. Kommissar für die Besitznahme und Huldigung wurde General v. Möllendorff, zum 2. Kommissar der schlesische Justizminister v. Danckelmann ernannt. Der Huldigung ging die Grenzziehung, die durch eine Kommission, bestehend aus 3 Haupt- mit je 4 Unterabteilungen, vorgenommen wurde, voran.
Die Besitznahme erfolgte endgültig in der Zeit vom 7. - 24. April, das entsprechende Notifikationspatent war am 25.3.1793 ergangen. Die Huldigung nahm Danckelmann in Vertretung des Königs am 7. Mai in Posen entgegen. Ende Juli konnten Möllendorff und Danckelmann den Abschluss ihrer Mission melden.
Während der militärischen Besetzung lange Beratungen und Vorbereitungen vorausgingen, war für die verwaltungsmäßige Erfassung so gut wie keine Vorsorge getroffen worden. Lediglich der schlesische Provinzialminister Hoym zeigte an dem Gebiet, das an die von ihm verwaltete Provinz grenzte, Interesse und ließ eine Denkschrift mit dem Datum vom 29.12.1792 über die zukünftige Verwaltung der Provinz anfertigen. In diesem Bericht wird die neue Erwerbung als "Südpreußen" ("Prusse méridionale") bezeichnet, ein Name, der die Zustimmung des Königs fand und in der Folgezeit verwendet wurde.
Die eigentlichen Anordnungen über die Verwaltung der Provinz ergingen im Februar 1793. Zum südpreußischen Provinzialminister wurde Otto Karl Friedrich v. Voß ernannt. Er war gehalten, in der Verwaltungseinrichtung mit dem Chef des ost- und südpreußischen Departements des Generaldirektoriums, dem Oberpräsidenten v. Schroetter, und dem schlesischen Provinzialminister v. Hoym zusammenzuarbeiten.
Voß versah jedoch nur reichlich eineinhalb Jahre sein neues Amt, am 27. September 1794 wurde er seines Postens wegen des Polnischen Aufstandes enthoben. Sein Nachfolger wurde Karl Georg Heinrich Graf v. Hoym, der seit 1770 Provinzialminister von Schlesien war und dieses Amt auch bei Übernahme der neuen Aufgabe beibehielt.
Durch Kabinettsorder vom 7. April 1793 wurde Südpreußen dem Generaldirektorium unterstellt. Bis zum Abschluss der Verwaltungseinrichtung erhielt Voß jedoch die alleinige Leitung mit Ausnahme des Justizwesens. Nach seiner Entlassung wurde die Provinz aus dem Generaldirektorium herausgelöst und Hoym die alleinige Verwaltung übertragen. Er sollte die Provinz bis zum Abschluss der Einrichtung der Verwaltung in der gleichen Weise wie Schlesien verwalten.
Am 12. März 1799 wurde Voß erneut das südpreußische Departement übertragen. Bei dieser Regelung blieb es bis zum Ende der preußischen Herrschaft in Südpreußen.
Alle die Verwaltung betreffenden Bestimmungen hatten das Ziel, die neue Provinz auf "preußischen Fuß" einzurichten.
II. Die Verwaltung der Justiz-, Hoheits- und Lehnssachen
Das Justizwesen in Südpreußen wurde 1793 dem schlesischen Justizminister v. Danckelman übertragen, dem vor allem die Einrichtung der Justizbehörden auf der mittleren Ebene oblag. Er traf seine Maßnahmen zusammen mit Voß sowie Hoym und Schroetter, ohne sich mit dem Großkanzler und Chef der Justiz Carmer in Verbindung zu setzen, was dessen Protest hervorrief. Die Differenzen zwischen diesen beiden Ministern fanden erst ihr Ende, als Danckelmann nach Beendigung der Justizeinrichtung im Jahre 1797 wieder abberufen wurde und das Justizdepartement in Berlin die zentrale Verwaltung der Justizsachen auch für Südpreußen übernahm.
Innerhalb des Justizministeriums, das nach Provinzial- und Sachreferaten gegliedert war, oblag dem Großkanzler Goldbeck neben anderen Provinzen auch die Leitung der Justiz in Südpreußen. Als dieser 1799 an Carmers Stelle als Chef der Justiz trat, ging die Provinz an Massow über.
Mit Justizangelegenheiten der neuen Provinz war auch die Gesetzeskommission unter Leitung des Großkanzlers Carmer, ab 1799 Goldbeck, befasst.
Alle Angelegenheiten, die Hoheitsrechte betrafen, z. B. Besitznahme und Huldigung, gehörten zum Ressort des Departements der auswärtigen Angelegenheiten. Ihm oblag auch die Ausfertigung der Nominations- und Konfirmationspatente für die Bischöfe.
In den südpreußischen Grenz-, Abschoss- und Arrestsachen konkurrierte das Kabinettsministerium mit dem Südpreußischen Departement des Generaldirektoriums.
Die Aufsicht über das Lehnswesen hatte das Lehnsdepartement, das mit dem Justizdepartement verbunden war und unter Leitung des Lehnsdirektors des Staats- und Justizministers v. d. Reck, stand.
Nach den Veränderungen im Auswärtigen Departement 1802 wurden dem Lehnsdepartement durch die bisher vom ersteren verwalteten Angelegenheiten des königlichen Hauses und die Landeshoheitssachen zugewiesen. In der mittleren Spähre oblag die Verwaltung der Justiz- und Lehnssachen den Regierungen, während die Hoheitsrechte von den Kammern wahrgenommen wurden. In diesen Fragen hatte es zunächst Differenzen zwischen den Provinzialministern Voß und Hoym einer - und den Großkanzlern Carmer und Goldbeck anderseits gegeben, die erst durch das neue "Reglement über die Verteilung der Geschäfte zwischen den südpreußischen Landeskollegiis" vom 15.12.1795 beigelegt wurden.
Die Regierungen waren neben der Zivil-, Kriminal- und freiwilligen Gerichtsbarkeit auch für die Besorgung des Hypothekenwesens und der Vormundschaftssachen zuständig.
Die Einrichtung der Regierungen erfolgte später als die der Kammern. Beide Kollegien waren in denselben Städten untergebracht, nämlich in Posen und Lenczycz bzw. Petrików. Für Plock wurde, da der Sprengel der Petrikówer Regierung zu groß war, zunächst eine Deputation genehmigt, die dann im April 1794 in eine Regierung umgewandelt wurde. Da die Stadt Plock jedoch nicht in der Lage war, Kammer und Regierung aufzunehmen, musste das für die Plocker Regierung vorgesehene Gebiet in Justizsachen weiterhin von Petrików verwaltet werden. Schließlich wurde die für Plock genehmigte Regierung in Thorn etabliert, wo sie ihre Tätigkeit am 1.6.1795 begann.
Die nach der Neuerwerbung von Neuostpreußen vorgenommene Änderung der Verwaltungsgrenzen Südpreußens machte eine Verlegung der Regierungen erforderlich. Im Februar 1796 wurde eine Deputation der Thorner Regierung nach Warschau entsandt, später siedelte die gesamte Regierung nach dort über. Während die Regierung in Posen beibehalten wurde, musste das Petrikówer Kollegium nach Kalisch umziehen. Weitere Veränderungen der Regierungssitze traten bis 1806 nicht ein.
Die Regierungen setzten sich jeweils aus einem Präsidenten, einem Direktor, bzw., wenn dieser ein Adliger war, einem Vizepräsidenten, Regierungsräten, Assessoren, Referendaren, Kanzlisten, Translatoren u. a. Unterpersonal zusammen. Jede Regierung bildete zwei Senate, wobei der zweite die Appellationen des ersteren erkannte. Revisionsinstanz war das Obertribunal in Berlin.
Von den Regierungen ressortierten die Kreisjustizkommissionen sowie die für Criminalia zuständigen Inquisitoriate.
III. Die Verwaltung der geistlichen und Schulangelegenheiten in Süd- und Neuostpreußen
Oberste Behörden für die Kirchen- und Schulsachen waren das mit dem Justizdepartement verbundene Geistliche Departement bzw. das 1787 eingerichtete Oberschulkollegium. Das Geistliche Departement bestand seinerseits wieder aus zwei Departements, u. zw.
I. dem Reformierten geistlichen Departement und
II. dem Lutherischen geistlichen Departement,
das auch für die katholischen geistlichen Angelegenheiten der einzelnen Provinzen, ausgenommen jedoch Süd- und Neuostpreußen, zuständig war. Die katholischen geistlichen und Schulangelegenheiten dieser Provinzen oblagen den beiden Provinzialdepartements des Generaldirektoriums.
Bei den Schulangelegenheiten muss bemerkt werden, dass die Provinzialminister hier weitgehend selbständig waren. Trotz der Ressortverbindungen zum Geistlichen Departement und Oberschulkollegium, das ohnehin auf die Aufsicht über das lutherische Schulwesen beschränkt war, sind die Schulangelegenheiten in den Provinzialdepartements zusammenfassend bearbeitet worden. Massows Anfrage aus dem Jahre 1805, ihm die Aufsicht über das katholische Schulwesen in beiden Provinzen zu übertragen, stießen auf den Widerstand Voß' und Schroetters, die beim König die Belassung des bisherigen Zustandes erreichten.
Hinsichtlich der Mittelbehörden waren bis zur Einführung des Ressortreglements für Südpreußen am 15. Dezember 1795 vor allem die Kammern, aber auch die Regierungen für alle Konfessionen zuständig gewesen. Das Ressortreglement wies den Kammern alle Konfessionen, mit Ausnahme der protestantischen, zu.
Die Verwaltung der evangelisch-reformierten und evangelisch-lutherischen Angelegenheiten war in beiden Provinzen verschieden geregelt. In Südpreußen waren für die ersteren die bei den Regierungen bestehenden Konsitorien zuständig, während in Neuostpreußen dieselben Aufgaben von den bei den Kammern bestehenden Geistlichen Deputationen versehen wurden, die darüber hinaus auch für die anderen Konfessionen zuständig waren.
In gleicher Weise war das Schulwesen aller Konfessionen geregelt.
Die Bevölkerung beider Provinzen war überwiegend römisch-katholisch; Protestanten, Griechisch-Katholische und Griechisch-Unierte befanden sich bei weitem in der Minderheit.
Die bisherige Diözesaneinteilung (Erzbistum Gnesen mit den Suffraganen Posen und Plock) wurde zunächst beibehalten, jedoch die Gebiete, die zu österreichischen bzw. russischen Bistümern gehörten, diesen nicht unterstellt. Stattdessen wurden in Wigry und Warschau zwei neue Bistümer eingerichtet und ein Teil des früher zur Krakower Diözese gehörenden Gebiets dem Bistum Breslau zugewiesen. Die Ernennung der Bischöfe durch das Departement der auswärtigen Angelegenheiten erfolgte ohne vorherige Befragung Roms.
Beide Bistümer, Wigry und Warschau, waren keine Suffragane von Gnesen, sondern unterstanden dem Papst direkt.
Für die in Neuostpreußen vorhandenen Griechisch-Unierten, die bis 1795 dem Metropoliten von Kiew bzw. dem Bischoff von Brest unterstellt waren, wurde ein eigenes Bistum in Suprásl errichtet, das auch für die griechisch-unierten Bevölkerungsteile in Südpreußen zuständig war.
Der Plan, auch für die Anhänger der griechisch-orthodoxen Kirche einen Bischof zu ernennen, wurde aus verschiedenen Gründen fallengelassen, statt dessen unterstellte man sie direkt dem Patriarchen in Konstantinopel.
B. Kanzlei- und Registraturgeschichte
Im Februar - März 1793 - das genaue Datum lässt sich nicht ermitteln - beantragte das Auswärtige Departement beim König die Einrichtung einer besonderen Expedition für Südpreußen innerhalb der Geheimen Staatskanzlei, in der die zum Ressort des Justiz- und Geistlichen Departements gehörenden Sachen expediert werden sollten. Der Antrag und der für das Personal erforderliche Etat wurden genehmigt. Die Kanzleidirektion wurden dem Geheimen Sekretär Poll übertragen und der Kriegsrat Kunowski zum Geheimen expedierenden Sekretär der Südpreußischen Expedition ernannt. Da das Ressortreglement noch nicht vorlag, ergaben sich bald Schwierigkeiten. Die Einrichtung des Justizwesens oblag, wie bereits erwähnt, dem schlesischen Justizminister v. Danckelmann, der seinen Sitz in Breslau hatte. Er unterstand, um die Verwaltungsmaßnahmen zu beschleunigen, direkt dem König und ließ die erforderlichen Ausgänge in der Breslauer Kanzlei expedieren, eine Maßnahme, die für die Geheime Staatskanzlei in Berlin eine finanzielle Einbuße bedeutete. Das Auswärtige Departement schlug deshalb vor, dass eilige Sachen in Danckelmans Expedition ausgefertigt und in ein besonderes Journal eingetragen werden sollten, wofür der Südpreußischen Expedition in Berlin am Ende des Jahres angemessene Gebühren zu entrichten waren. Danckelman war mit dieser Regelung einverstanden. Meinungsverschiedenheiten gab es zwischen Danckelman und den Kabinettsministern wegen der Expedierung der Ausgänge in evangelisch-geistlichen Sachen. Schließlich kam im März 1794 ein Vergleich zustande, der der Südpreußischen Expedition der Geheimen Kanzlei folgende Ausfertigungen zuwies:
"1.) Standeserhöhungen, Legitimationspatente, Hof- und Landeschargen und -ämter,
2.) Inkolatsdiplome und Konzessionen zum Besitz adliger Güter für adlige und bürgerliche auswärtige und einheimische Personen,
3.) Konfirmations-, Kollations-, Nominationspatente und Placis für die südpreußischen Bischöfe, Prälaten, Äbte und Inhaber anderer Benefizien,
4.) Von den Konfirmationen der evangelisch-lutherischen Geistlichen
a) für alle die Stellen in den Städten, welche unter dem unmittelbaren Patronatsrecht des Königss stehen, wo aber das Gehalt nicht aus einer königlichen Kasse fließt,
b) für alle die Stellen, wo andere Patrone das Jus vocandi haben.
Dasselbe gilt für die Schul- und Seminarbedienten."
Die Südpreußische Expedition der Geheimen Staatskanzlei bestand am 1.1.1803 aus folgenden Beamten:
Expedient: Kunowski (Kriegsrat)
Exdradent: Poll (Kriegsrat)
Kanzlist: Küsel (Geheimer Sekretär)
Kanzlist: Kraatz jun. (Geheimer Sekretär)
Kanzlist: Grumm (Geheimer Sekretär)
Kanzlist: Giehrisch (Geheimer Sekretär)
Kopist: Grumm (Geheimer Sekretär).
Die gesamte Kanzlei verfügte über 4 resp. 9 Kanzleidiener.
Der Geheime Registrator Weinhold war für die ost-, west- und südpreußischen Akten zuständig.
Durch das Regulativ vom 28. Februar 1803 wurde die bisher gemeinsame Staatskanzlei des Auswärtigen, Justiz- und Geistlichen Departements, die in Provinzialexpeditionen unterteilt war, aufgelöst. Vorausgegangen war eine Veränderung im Ressort des Kabinettsministeriums; die dort bisher bearbeiteten Angelegenheiten des königlichen Hauses und Hoheitssachen fielen dem Lehnsdepartement zu.
Nach dem "Regulativ wegen der Auflösung der bisherigen Geheimen Staatskanzlei und Registratur" vom 28. Februar 1803 erhielten
- das Auswärtige Departement
- das kombinierte Justiz- und Geistliche Departement, das in das Departement des Großkanzlers von Goldbeck und die Departements der Staatsminister v. Thulemeyer, v. Massow und v. d. Reck zerfiel und
- das Lehns- und Hoheitsdepartement
eigene Kanzleien. Lediglich die Registratoren, deren übernommene Zahl nicht ausreichte, um jeden Departement einen zuzuweisen, hatten mehrer Departements zu versehen. Die Dienstpflichten der Registratoren wurden durch Reglements geregelt. Das erneuerte Reglement vom 4. Juni 1801 für die aus der Geheimen Kanzlei, der Geheimen Registratur und dem Geheimen Archiv beschäftigten Beamten weist die Registratoren an, "ihren äußersten Fleiß dahin anzuwenden, daß die von den Extradenten an sie abgelieferte Konzepte und übrige zu einer bisher nicht abgemachten Sache gehörigen Stücke sorgfältig in chronologischer Ordnung nach den Datis der Exhibitorum gelegt, auch zusammengeheftet und rubrizieret, mithin solchergestalt Acta jederzeit in guter Ordnung und Kompletten Stande gehalten werden". Ferner sollen die Registratoren die Akten in die Registraturbücher und Repertorien eintragen und nach Ablauf eines Jahres an das Geheime Archiv abliefern, es sei denn, die Schriftstücke würden für den laufenden Geschäftsgang noch gebraucht.
Die Aufgaben der Registratoren blieben auch nach der Auflösung der Geheimen Staatskanzlei und Registratur im wesentlichen dieselben. Die Registratoren trugen die Schriftstücke nach Stichworten mit Angabe des Datums sowie einer Registratursignatur in die jährlich angelegten Indices ein.
Die Südpreußen betreffenden Schriftstücke wurden seit 1793 in der oben erwähnten Weise in die schlesischen Indices eingetragen (C 200 - 210, 1793 - 1803) und zwar gesondert.
Nach Auflösung der Geheimen Staatskanzlei und der Geheimen Registratur wurden in den Registraturen der einzelnen Departements besondere Indices geführt.
Bei dem Kriminaldepartement und Justizdepartement wurde keine Unterabteilung nach Provinzen vorgenommen; beim Geistlichen Departement finden wir Neuostpreußen mit den Provinzen Neuost-, Ost-, Westpreußen, Schlesien und Pommern jeweils in einem Band (D 15, 18, 21, 24) vereinigt. In den Indices des Hoheitsdepartements war Südpreußen 1804 mit Ost-, West-, Neuostpreußen, Schlesien und Pommern in einem Band (D 28) vereinigt, von 1805 - 1807 ist es mit den Provinzen Brandenburg, Schlesien und Ostfriesland in mehreren Bänden zusammengefasst (D 30, 33, 36).
Dieselbe Zusammenfassung weist der Indexband des Auswärtigen Departements für die Jahre von 1804 - 1812 auf.
C. Bestandsgeschichte
Wie bereits erwähnt, verblieben die Akten in der Geheimen Registratur bzw. den Geheimen Registraturen in der Regel nur ein Jahr und gelangten dann in das Geheime Archiv. Für die Aufnahme der Akten war hier 1793 die Repositur 7 C angelegt worden.
Die Akten gelangten zusammen mit den "Registraturbüchern" (B 30, B. 31 festgesetzt für Posen) an das Archiv. Diese Registraturbücher weisen folgende Untergliederung auf:
(1) Bestallungen und Gnadensachen
(2) Consistorialia bzw. Ecclesiastica
(3) Criminalia bzw. Fiskalia
(4) Feudalia
(5) Intercessionalia
(6) Monatsakten.
Seit 1803 - im Zusammenhang mit den Kanzlei- und Registraturveränderungen - teilte sich die 5. Rubrik in Auswärtige Departementssachen und in Hoheitsdepartementssachen. Zu den Registraturbüchern bestanden Indices, die gleichfalls zusammen mit den Akten an das Archiv abgegeben wurden. Die Registraturbücher blieben auch im Archiv kurrent, da nach jedem Vorgang die Repositur- und Konvolutnummer vermerkt, unter der das Schriftstück im Archiv untergebracht worden war. Dem Pertinenzprinzip entsprechend, gelangte der größte Teil der einkommenden, Südpreußen betreffenden Schriftstücke in die Rep. 7 C, während andere in den Reposituren 7, Preußen; 9, Allgemeine Verwaltung; 9, Polen und 11, Auswärtige Angelegenheiten, abgelegt wurden.
Bereits 1796 ist ein "Südpreußisches Repertorium über alle seit der Anno 1793 erfolgten Besitznahme von Südpreußen zum Königlichen Geheimen Archive gekommenen Acta" angelegt worden, das in der Folgezeit durch Eintragungen laufend ergänzt und bis zu der von Friedlaender vermutlich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angefertigten Analyse verwendet wurde. Die Verzeichnung der Schriftstücke im Registraturbuch sowie die Anfertigung des Repertoriums geschah durch den Geheimen Archivar Kahlen, der von 1795 bis 1806 die Akten der Provinzen Schlesien, Südpreußen und Ostfriesland bearbeitete.
Die Gliederung der Repositur ist die für Territorialreposituren charakteristische nach Stichworten, deren Abfolge alphabetisch (Nr. 1: Besitznahme, Nr. 47: Vasallensachen) ist und die eine Anlehnung an Rep. 46 B Schlesien seit 1740, zeigt.
Durch den Tilsiter Frieden vom 9. Juli 1807 musste Preußen die Provinzen Süd- und Neuostpreußen an das Herzogtum Warschau abtreten und auch die diese Gebiete betreffenden Akten der Unter-, Mittel- und Zentralbehörden ausliefern. Die Übergabe war im Artikel 26 des Vertrages festgelegt, sie sollte durch preußische hierfür beauftragte Kommissare an Kommissare der betreffenden Länder drei Monate nach der Ratifikation des Vertrages erfolgen.
Mit der Ausführung der Bestimmungen des Tilsiter Friedens war eine Immediatkommission beauftragt worden, die ihre Instruktion am 31. Juli erhielt. Für die Aktenauslieferung war in der Kommission der Geheime Legations- und Oberjustizrat v. Raumer zuständig, ihm beigegeben waren die Geheimen Archivare Klaproth, Wernitz, Kenkel und Kahlen. Später kam der Kriegsrat Troschel hinzu, der auf Grund seiner diplomatischen Fähigkeiten bei dem Auslieferungsgeschäft auf preußischer Seite bald die führende Rolle spielte.
Französischer Kommissar war der Generaladministrator der Finanzen und Domänen, Bignon, der sich durch einen seiner Sekretäre, D'Aubignose, vertreten ließ. Sächsisch-polnischer Beauftragter war der Landgerichtsdirektor v. Szaniawski, der von dem ehemaligen Registrator an der Warschauer Kriegs- und Domänenkammer, Briesemeister, unterstützt wurde.
Der Artikel 26 des Friedensvertrages wurde von preußischer Seite spezifiziert durch eine besondere Instruktion für den Geheimen Archivar Klaproth.
Die Aussonderungen begannen an den Akten des Geheimen Staatsarchivs, die Klaproth auf der Flucht nach Ostpreußen mitgenommen hatte und wurden dann in Berlin fortgesetzt.
Bereits am 6. Oktober meldete das Geheime Staatsarchiv der Immediatkommission den Abschluss der Aussonderungsarbeiten.
Da die preußischen Beauftragten den Standpunkt vertraten, die Archivalien des Geheimen Staatsarchivs beträfen den ganzen preußen Staat und seien daher nicht teilbar, hatten sie lediglich den Preußen 1799 zugesprochenen und übergebenen Teil des polnischen Reichsarchivs ausgesondert.
Dieser Standpunkt war jedoch durch den Verlauf der Ereignisse überholt. Die Franzosen, die sich mit dem Recht des Siegers in die Auslieferungsgeschäfte einmischten, hatten die zunächst von preußischer Seite verwehrte Aussonderung der Akten aus den Registraturen des Generaldirektoriums erreicht.
Nachdem die Akten aus der westpreußischen Registratur des Generaldirektoriums ausgesondert waren, nahm man dieselbe Arbeit im Geheimen Archiv vor, zunächst beim polnischen Reichsarchiv, dann in der Rep. 7 B, Westpreußen.
Die Rep. 7 C, Südpreußen, beabsichtigten die Kommissare in toto zu übernehmen, was jedoch durch einen Protest seitens der preußischen Kommissare und der Friedensvollziehungskommission verhindert wurde.
Als nächster Bestand wurde die Rep. 7 A, Neuostpreußen, ausgesondert und versiegelt. Anschließend, im Januar 1808, wurden die Registraturen des Geistlichen und des Hoheitsdepartements durchgesehen.
Die Verpackung und der Abtransport der ausgesonderten Akten nach Warschau geschah im Februar und März 1808. Ihre Unterbringung in Warschau erfolgte in dem am 2. September 1808 gegründeten Hauptlandesarchiv, das auch alle anderen Akten aus den Registraturen der preußischen Zentralbehörden aufnahm.
Die Verzeichnung der Akten des Preußischen Geheimen Staatsarchivs von Südpreußen, Neuostpreußen, Westpreußen und Neuschlesien wurde von dem Beamten des Hauptlandesarchivs, Jasnogorski, in deutsch in den Jahren 1809 - 1810 vorgenommen. Insgesamt sind von ihm 4822 Faszikel in drei Bänden verzeichnet worden. Um die Benutzung des Bestandes zu erleichtern, fertigte Jasnogorski darüber hinaus einen Index an, dessen Benutzung jedoch dadurch erschwert war, dass innerhalb der Buchstaben eine alphabetische Ordnung fehlte. Ein streng alphabetisches Register, das allerdings nur die Namen erfasste, wurde 1840 - 1846 von dem Archivar Bentkowski anhand des Jasnogorskischen Repertoriums hergestellt. Beide Indices sind im hiesigen Archiv nicht vorhanden.
Bei der Verzeichnung ging Jasnogorski folgendermaßen vor: Zuerst bearbeitete er die Pakete 1 - 20, die westpreußische Akten betrafen. Während im Reperorium vermerkt ist, welche Akten sich in welchem Paket befanden, ist auf den Akten selbst rechts unten nur die Nummer vermerkt, die er den Akten gab. Die Pakete 21 - 148 enthielten südpreußische Akten, während die neuostpreußischen sich in den Paketen 149 - 191 befanden. Daran schlossen sich - im allgmeinen nach den drei Provinzen verpackt - 20 Pakete "Miscellanea", diese Akten waren den Registraturen der betreffenden Departements entnommen und noch nicht an das Archiv gelangt, sie tragen daher größtenteils auch keine Signaturen.
Durch den Wiener Kongress von 1815 gelangte ein kleiner Teil der Gebiete des ehemaligen Großherzogtums Warschau, die spätere Provinz Posen, und der Südteil von Westpreußen, wieder an Preußen. Der am 3. Mai zwischen Preußen und Russland geschlossene Vertrag behandelte in seinem § 39 die Auslieferung der Archivalien, auf Grund dessen Preußen die 1807/08 an Polen ausgelieferten Archivalien, die die oben genannten Gebiete betrafen, zurückfordern konnte.
Die Auslieferungsverhandlungen, die von preußischer Seite vom Geheimen Oberfinanzrat Knobloch geleitet wurden, begannen im September 1815 und wurden erst Ende 1820 abgeschlossen. Durch die Unkenntnis der preußischen Beauftragten über Umfang, Inhalt und Bedeutung der nach dem Tilsiter Frieden an Warschau ausgelieferten Akten sowie deren oberflächliche Aussonderung verhinderten, dass Preußen alle ihm nach Artikel 38 des Vertrages vom 3. Mai 1815 zustehenden Akten ausgeliefert wurden. Ihre offizielle Übergabe an das Geheime Staatsarchiv erfolgte im November 1820.
Während des 1. Weltkrieges beschäftigte sich die "Deutsche Archivverwaltung beim Kaiserlich-Deutschen Generalgouvernement Warschau" eingehend mit dem Schicksal der nach dem Tilsiter Frieden an Polen ausgelieferten Akten, wobei sie die Absicht verfolgte, diese nach Berlin zurückzubringen. Die revolutionären Ereignisse im November 1918 ließen diesen Plan jedoch nicht zur Ausführung gelangen.
Während des 2. Weltkrieges ließ die von den Deutschen eingerichtete sogenannte Archivverwaltung des "Generalgouvernements Polen" ehemals preußische Akten sammeln und nach Berlin in das Geheime Staatsarchiv überführen. Eine Einarbeitung in die betreffenden Bestände fand infolge des Personenmangels nicht statt. Die Akten sind daher in derselben Verpackung, in der sie aus Warschau kamen, nach Staßfurt und Schönebeck ausgelagert worden.
Am 12. Mai 1873 beauftragte das Generaldirektorium der Staatsarchive den Geheimen Archivar Reuter, anhand der Akten von Rep. 72, Immediatkommission zur Vollziehung des Tilsiter Friedens, einen Bericht zu erstatten, "der für beide Zentralarchive für künftig zu erledigende Requisitionen aus dem Bereiche der damals abgetretenen Provinzen zur Grundlage dienen kann". Reuter fertigte daraufhin 2 Berichte an, denen er spezifizierte Aktenverzeichnisse beifügte, die jedoch den Berichten entnommen worden sind.
1921 beschloss man im damaligen Preußischen Geheimen Staatsarchiv, für die bisher ungenügend verzeichneten Reposituren 7 A, 7 B und 7 C morderne Findbücher anzufertigen. Für die Repertorisierung hatte man den Archivrat Dr. Warschauer vorgesehen, der sich in der Materie genau auskannte und bereit war, die Arbeit auf Honorarbasis zu übernehmen. Er unterzog sich dieser Aufgabe in den Jahren 1921 - 1923, wobei zugleich ein Register und entsprechende Einleitungen angefertigt wurden. Über den Verbleib der letzteren ist nichts bekannt. Die von Warschauer angefertigten Repertorien und Register wurden dann von einem Beamten des Archivs ins reine übertragen. Warschauer behielt die alte Einteilung nach Nummern bei, bei solchen Nummern, deren Akten vollständig nach Warschau abgegeben waren, vermerkte er dieses durch "fehlt". Innerhalb der Nummern sind die Faszikel durchnummeriert worden.
Im Deutschen Zentralarchiv wurden die ehemals in einer Repositur vereinigt gewesenen und denselben Registraturen entstammenden Akten wieder zu einem Bestand vereinigt. Dieses geschah in den Jahren 1957 - 1962 durch den staatl. gepr. Archivar Henning.
Die Einordnung der Akten war im allgemeinen einfach, da sie fast alle die Signatur des Geheimen Staatsarchivs trugen und so die Zugehörigkeit zu der betreffenden Nummer ersichtlich war, der sie angeschlossen wurden.
Die am Schluss der Abgabe befindlichen Pakete "Miscellanea" (Paket Nr. 195 und 200 - 209 a), die südpreußische Angelegenheiten beinhalten, entstammen der laufenden Registratur und besaßen noch keine Archivsignatur. Sie wurden entsprechend ihrem Inhalt auf die einzelnen Nummern und Unternummern verteilt.
Das vorliegende Findbuch enthält somit den gesamten ehemals in der Rep. 7 C vereinigt gewesenen und jetzt im DZA Merseburg befindlichen Bestand "Südpreußen".
Die Akten der sogenannten "Warschauer Ablieferung" sind durch die doppelte Signatur zu erkennen. In den linken Spalten des Findbuchs ist die den Akten im DZA, Abt. Merseburg, gegebene Signatur eingetragen. Die Spalte "alte Signatur" vermerkt die Paketzahl und die Nummer, die Jasnogorski den 1808 nach Warschau abgegebenen Akten gab.
Da die Akten der "Warschauer Ablieferung" an die einzelnen Nummern angeschlossen wurden, bleibt das von Warschauer angefertigte Repertorium weiterhin kurrent. Eine Konkordanz der im vorliegenden Findbuch verzeichneten Akten der sogenannten "Warschauer Abgabe" und dem Jasnogorskischen Repertorium ist gleichfalls vorhanden, da im letzteren in der rechten Spalte jeweils die heutige gültige Signatur vermerkt ist.
Die nach dem Wiener Kongress nach Berlin zurückgekehrten Akten des Bestandes sind in der Weise gekennzeichnet, dass die ihnen von Jasnogorski gegebenen Nummern in Klammern in der Spalte "alte Signatur" vermerkt sind.
Trotz der Vereinigung der beiden Teilbestände enthält das vorliegende Findbuch nicht alle 1808 nach Warschau abgelieferten Akten, da die polnischen Behörden in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts häufig Akten vom Hauptlandesarchiv für die laufenden Geschäfte anforderten und auch erhielten, jedoch zu einem großen Teil nicht zurücksandten. Geringe Lücken sind ferner durch Krieg und Auslagerung entstanden.
Die Repositur 7 C umfasst ca. 5000 Faszikel = 35 lfm.
D. Hinweise
I. Quellen- und Literaturhinweise
1) Quellen
a) gedruckte Quellen
Bussenius, Ingeburg: Die Preußische Verwaltung in Süd- und Neuostpreußen, 1793 - 1806 = Studien zur Geschichte Preußen, Bd. Heidelberg, 1906
Prümers, Rodgero: Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreußens = Sonderveröffentlichungen der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, III, Posen, 1895
b) ungedruckte Quellen
I. HA GR, Rep. 7 A Nr. 24 Fasz. 1, Die Ressortveränderungen der Armen- sowie der Kirchen-, Schul- und Stiftssachen in Neuostpreußen, 1804
I. HA GR, Rep. 7 A Nr. 24 Fasz. 3, Besitznehmung, Begrenzung und Huldigung in Südpreußen, 1793
I. HA GR, Rep. 9 J 3 ad Fasz. 115, Die Übernahme der geistlichen Angelegenheiten für Süd- und Neuostpreußen durch v. Massow, 1798
I. HA GR, Rep. 9 L 12 Fasz. 9, Der Südpreußischen Expedition im Geheimen Staatsarchiv zukommenden Ausfertigungen und die ihr deshalb erteilte Instruktion, 1793 - 1794
I. HA GR, Rep. 9 L 12 Fasz. 18, Auflösung und Verteilung der Geheimen Staatskanzlei und Registratur, 1802 - 1803
I. HA GR, Rep. 9 L 12 Fasz. 19, Der Geschäftsgang in der Geheimen Staatskanzlei, 1802 - 1805
I. HA GR, Rep. 9 L 12 Fasz. 32, Das neue Reglement für die Geheime Staatskanzlei, das Archiv und die Registratur, 1800 - 1801
I. HA Rep. 84 VII Nr. 525, Die geistlichen Sachen in Südpreußen und in der neuen Provinz Neuostpreußen, 1796 - 1802
I. HA Rep. 89 Nr. 120 A, Die Zustände und die Verwaltung von Südpreußen, 1799 - 1806
I. HA Rep. 96 Nr. 242 A, Erwerbung, Organisation und Verwaltung von Südpreußen, Bd. 1 - 5, 1793 - 1797
I. HA Rep. 96 Minüten Bd. 93, Südpreußen, 1793 - 1794
I. HA Rep. 178 VII Nr. 11, Die Ordnung der Bestände des Geheimen Staatsarchivs, Bd. 1, 1862 - 1875
I. HA Rep. 178 VII Nr. 11, Die Ordnung der Bestände des Geheimen Staatsarchivs, Bd. 3, 1891 - 1936
II. HA, Gen. Dir. Generaldepartement Tit. LXXXIX Nr. 3, Das für die südpreußische Landeskollegien zu entwerfende Ressortreglement, 1793 - 1795
2.) Darstellungen
Blöß, Wolfgang: Zur Geschichte der "Warschauer Akten" [Maschr., nur für den Dienstgebrauch]
Bussenius, Ingeburg und Walther Hubatsch [Hrsg.]: Urkunden und Akten zur Geschichte der preußischen Verwaltung in Südpreußen und Neuostpreußen, 1793 - 1806, Bonn, 1961
Heike, Otto: Die Provinz Südpreußen. Preußische Aufbau- und Verwaltungsarbeit im Warthe- und Weichselgebiet = Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Mitteleuropas, hrsg. von Joh. Gottfried Herder, Institut Marburg
Warschauer, Adolf: Die preußischen Registraturen in den polnischen Staatsarchiven = Veröffentlichungen der Archivverwaltung bei dem Kaiserlich-deutschen Generalgouvernement Warschau, Warschau 1918
II. Hinweise auf ergänzende Bestände
I. HA GR, Rep. 7 Preußen, bes. Nr. 166 b
I. HA GR, Rep. 7 A Neuostpreußen
I. HA GR, Rep. 9 Polen
I. HA Rep. 76 (alt) Ältere Oberbehörden für Wissenschaft, Kunst-, Kirchen- und Schulsachen, I. Oberschulkollegium
I. HA Rep. 81 Gesandtschaft Warschau, Generalkonsulat Warschau
I. HA Rep. 84 Justizministerium zur Revision der Gesetzgebung; verschiedene mit ihm zusammenhängende Gesetzkommissionen; Akten der Großkanzler v. Carmer und v. Goldbeck
I. HA Rep. 89 Geheimes Zivilkabinett, 1797 - 1806
I. HA Rep. 92 Nachlass Hoym
I. HA Rep. 92 Nachlass Klewitz
I. HA Rep. 92 Nachlass Voß
I. HA Rep. 96 Zivilkabinett Friedrich Wilhelms II.
II. Generaldirektorium Südpreußen
II. Generaldirektorium Neuostpreußen
Merseburg, im Oktober 1963
Kohnke
Zitierweise: GStA PK, I. HA GR, Rep. 7 C
- Bestandssignatur
-
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA GR, Rep. 7 C
- Umfang
-
Umfang: 32 lfm (6575 VE); Angaben zum Umfang: 32 lfm (6581 VE)
- Sprache der Unterlagen
-
deutsch
- Kontext
-
Tektonik >> ZENTRALE VERWALTUNGS- UND JUSTIZBEHÖRDEN BRANDENBURG-PREUSSENS BIS 1808 >> Geheimer Rat >> Territorial-Reposituren >> Verwaltung und Rechtsprechung in den seit 1609 erworbenen Territorien (chronologisch in der Reihenfolge der Erwerbungen)
- Bestandslaufzeit
-
Laufzeit: 1793 - 1810
- Weitere Objektseiten
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Letzte Aktualisierung
-
28.03.2023, 08:52 MESZ
Datenpartner
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- Laufzeit: 1793 - 1810