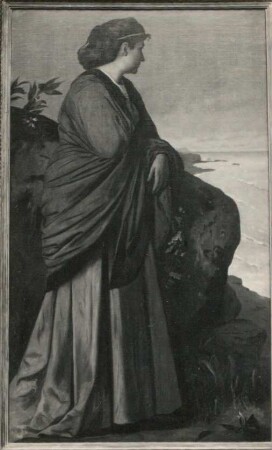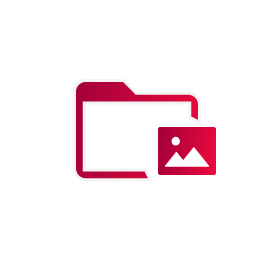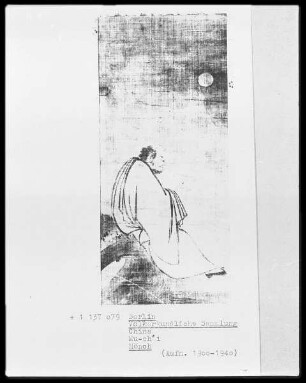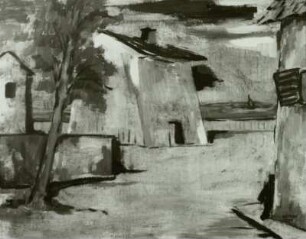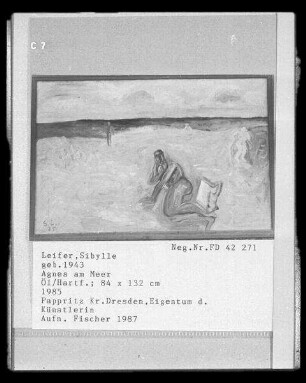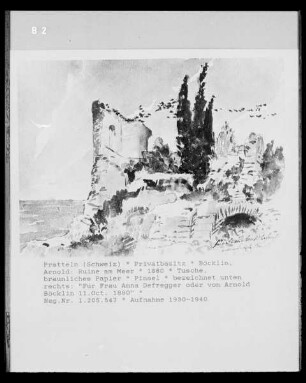Bild
Mönch am Meer
»Es ist nemlich ein Seestük, vorne ein öder sandiger Strand, dann, das bewegte Meer, und so die Luft. Am Strande geht tiefsinnig ein Mann, in schwarzem Gewande; Möfen fliegen ängstlich schreiend um ihn her, als wollten sie ihn warnen, sich nicht auf ungestümmen Meer zu wagen.« Mit diesen Worten beschrieb Caspar David Friedrich sein Gemälde »Mönch am Meer« (zit. nach: H. Börsch-Supan, Berlin 1810, in: Kleist-Jahrbuch, Berlin 1987, S. 74). Zwei Jahre arbeitete er an diesem Bild, das sein berühmtestes werden sollte. Mehrfache Veränderungen und Übermalungen bewirkten eine ungewöhnliche Abstraktion und unvergleichliche Radikalität der Komposition. Die überlieferten Vorstellungen von Landschaftsmalerei unterwandernd, hat Friedrich die klassischen Perspektivregeln außer Kraft gesetzt. In klarer Einfachheit ist das Bild horizontal in die drei Elemente Land, Meer und Himmel gegliedert. Bloßen Hauptes geht ein Mönch am Ufer entlang, Möwen umflattern ihn. Neben dem Menschen sind sie die einzigen Lebewesen. Vor dem Einsamen liegt in bleierner Schwärze das unermeßlich weite Meer. Die grauen Wolkenschleier über dem Wasser geben erst weiter oben überraschend den Blick ins Blau frei. Nie zuvor hat es in der Kunst eine solche Kompromißlosigkeit gegeben. Der Bildraum wirkt wie ein Abgrund. Es gibt keine Begrenzung, keinen Halt, nur den Schwebezustand zwischen Nacht und Tag, Zweifel und Hoffnung, Tod und Leben. 1810 wurde das Gemälde gemeinsam mit seinem Gegenstück »Abtei im Eichwald« (Nationalgalerie, Inv.-Nr. NG 8/85) auf der Berliner Akademieausstellung gezeigt und dort von König Friedrich Wilhelm III. erworben. Eindringlich hat Heinrich von Kleist unter Verwendung eines Textes von Clemens Brentano in den »Berliner Abendblättern« vom 13. Oktober 1810 die Magie dieses Bildes in Worte gefaßt: »Herrlich ist es, in einer unendlichen Einsamkeit am Meeresufer, unter trübem Himmel, auf eine unbegränzte Wasserwüste hinauszuschauen. Dazu gehört gleichwohl, daß man dahin gegangen sei, daß man zurück muß, daß man hinüber mögte, daß man es nicht kann, daß man Alles zum Leben vermißt, und die Stimme des Lebens dennoch im Rauschen der Fluth, im Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken, dem einsamen Geschrei der Vögel, vernimmt [...] und so ward ich Kapuziner, das Bild war die Düne, das aber, wo hinaus ich mit Sehnsucht blicken sollte, die See, fehlte ganz. Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reich des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis. Das Bild liegt mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen wie die Apokalypse da, als ob es Youngs Nachtgedanken hätte, und da es in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit, nichts als den Rahmen im Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären« (zit. nach: H. Börsch-Supan und K. W. Jähnig, Caspar David Friedrich, München 1973, S. 76). | Birgit Verwiebe
- Standort
-
Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin
- Inventarnummer
-
NG 9/85
- Maße
-
Höhe x Breite: 110 x 171,5 cm
Rahmenmaß: 128,5 x 189 x 12 cm
Gewicht: 72 kg incl. Verglasung
- Material/Technik
-
Öl auf Leinwand
- Ereignis
-
Erwerb
- (Beschreibung)
-
Aus dem zerstörten Berliner Stadtschloß. Seit 1957 Eigentum der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz
- Ereignis
-
Herstellung
- (wann)
-
1808-1810
- Letzte Aktualisierung
-
08.08.2023, 11:02 MESZ
Datenpartner
Alte Nationalgalerie. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bild
Entstanden
- 1808-1810